

Epigenetik bei Wildtieren Fütterung
von Wasserwild

WEIL ES MENSCHLICH IST

Dieser Sommer erinnert mich wettermäßig sehr an die niederschlagsreichen, ernteerschwerenden Tage im Juni, Juli und August meiner Kindheit und Jugendzeit. Vor etwa 50 Jahren war der Sommer „im Land des Regens“ wie der heurige. Die zahlreichen Hitzetage und Tropennächte der letzten Jahre sind heuer die seltene Ausnahme, ganz so wie früher. Unweigerlich erinnert mich dieser eigentlich ganz normale Sommer von damals an die Situation der Jagd. Vieles hat sich in der Jagd entwickelt und verändert; ob freiwillig, gewachsen oder erzwungen. Vor allem die Ansprüche an die Jägerinnen und Jäger haben sich in den letzten Jahrzehnten vervielfacht. Die Jagd hat immer mehr gesellschaftlichen Forderungen zu entsprechen, und viele Menschen – ob berechtigt oder nicht – beteiligen sich meist wortgewaltig mit ihren subjektiven Vorstellungen einer zeitgemäßen Jagd. So werden Funktionen, Dienstleistungen und Nützlichkeiten oft sehr fordernd definiert und die Jagd hat diesen Wandel gefälligst zu vollziehen... Oder ist da noch mehr?
Genauso wie die klimatische Veränderung uns scheinbar in südlichere Klimazonen verschiebt, verändern die angesprochenen Forderungen das Wesen der Jagd. Aber nur scheinbar! Denn das Wesen der Jagd, die Leidenschaft, unsere Empathie, das Eintauchen und Einswerden mit der Natur haben nur wenig mit Funktion, Dienstleistung, Nützlichkeit und Optimierung zu tun.
Das Wesen unserer Jagd drückt sich in der einzigartigen alpenländischen Jagdkultur aus. Nämlich als Naturverbundenheit, Demut, Dankbarkeit, Staunen, Stille, Traurigkeit, Freude und Leidenschaft. Diese Werte sind unverrückbar, zeitlos und zukunftsfähig. Diese Werte sind es auch, die so viele Jungjägerinnen und Jungjäger in unserer Zeit zur Jagd führen. Überall dort, wo die Jagd zur reinen Funktion und Dienstleistung verkommt, ist sie am Sterbegang. Unsere Jagd ist lebendig von großem gesellschaftlichem Interesse und enormem Zuwachs geprägt. Weil es menschlich ist, zu jagen, weil es in unseren Genen sitzt, Jäger zu sein.
Bekennen wir uns also gemeinsam zum Wesen der Jagd, zu ihrer Vielfalt und Individualität, zur Leidenschaft. Unser Werken und Wirken ist ein Ausdruck aber auch ein berechtigter Antrieb und ein Zeugnis für die Zukunft unserer geliebten Jagd.
Ein herzliches Weidmannsheil für die bevorstehende Herbstjagdzeit wünscht Herbert Sieghartsleitner Landesjägermeister von Oberösterreich



Dass Rebühner anpassungsfähig sind, zeigt dieses Foto, wo ein Scheunendach als Aussichtspunkt gewählt wurde. Foto: I. Koch

EDITORIAL

„In der Vielfalt liegt die Schönheit“
Wie wahr dieses Sprichwort ist, zeigt sich nicht nur in der Jagd und unserer Jägerschaft, sondern auch in diesem Oö Jäger, den Sie, liebe Leserin, lieber Leser, gerade aufgeschlagen haben.
Wir hoffen, dass für jeden etwas Spannendes dabei ist: ein Fachbeitrag zum Nachdenken und Wissenserweiterung, ein lebendiger Veranstaltungsbericht oder Beitrag aus den Bezirken und Revieren, der Lust auf Austausch und Begegnung macht.
Die Jagd schenkt uns Freude, Spannung und besondere Erlebnisse. Gleichzeitig verlangt sie Verantwortung, Sorgfalt und das Einhalten sämtlicher gesetzlicher Vorgaben – auch wenn das manchmal immer umständlicher und bürokratischer wird.
Unsere Geschäftsstelle ist jedenfalls immer für Sie da – mit Rat, Unterstützung und Service.
In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen! Ihr
Mag. Christopher Böck Geschäftsführer, Wildbiologe, Redaktionsleiter

JAGDMUSEUM SCHLOSS HOHENBRUNN

Gratis Eintritt für alle oö. Jägerinnen und Jäger. Wunderschönes Ambiente für Ihre Familien- und Firmenfeiern.


… ist in allen heimischen Gefilden unterwegs, ungesehen durchstreift er Wald und Flur, er sieht alles, hört alles und äußert sich höchstselten dazu. Der Frechdachs hat wohl seine eigene Meinung zu den Dingen, die er sieht. Allerdings belässt er es meist bei einem Schütteln seines mächtigen Kopfes, einem Schnauben, einem vergnügten Schmunzeln.
Und doch gibt es Themen, die ihn so ganz und gar nicht unberührt lassen und über die er dann gerne sinniert.
DIE GUTE ALTE ZEIT
Jüngst machte der Frechdachs unter einem sehr alten Baum eine kleine Pause. Der Baum ist keine hundert Jahre, sondern gleich mehrere hundert Jahre alt. Und plötzlich musste der Frechdachs schmunzeln, weil er daran dachte, wie oft die Menschen sagen: „Die gute alte Zeit“. Auch manche Jäger werden nicht müde zu betonen: „Früher war die Jagd noch ganz anders, viel echter. Überhaupt sei alles besser gewesen.“ Interessanterweise steigen in diesen Kanon auch mittelalte Menschen mit ein, die gar nicht wissen können, wie dieses „Früher“ überhaupt war. Der Frechdachs will sich da gar nicht ausnehmen. Über richtige Winter wird da gesprochen und dass die Jäger noch richtige Jäger waren, fast beiläufig fallen diese Sätze und niemand will sie so richtig hinterfragen. Offenbar vermittelt der Gedanke an die Vergangenheit ein tröstlicheres Gefühl als jener an die Zukunft.
Jedenfalls saß der Frechdachs da, lauschte dem Wind und wurde beinahe ein wenig sentimental, hat es sich dann aber doch anders überlegt.
Denn je mehr er nachdachte, desto bewusster wurde ihm, die Jagd ist ja kein Kinofilm voll nostalgischer Rückblicke. Sie war immer Motor. Hat die Menschheit ernährt, geformt und verbunden. Hat Gesellschaften verändert und sich dabei selbst verändert. Und für manche vielleicht überraschend, weil ojeoje so viele Veränderungen überdauert. Bis heute. Man kann der Jagd also im weiteren Verlauf der Menschheitsgeschichte noch einiges zutrauen. Jetzt so auf mehrere hundert oder tausend Jahre gedacht. Wie das wohl geschehen wird? Keine Ahnung. Das ist ja die Krux an der Zukunft, niemand kann sie voraussagen, man kann sie nur möglich machen.
Nur wer immer zurückblickt, wird halt nicht sehen, wo es lang geht. Und das wäre man der Jagd an sich schon schuldig. Hin und wieder am Hochstand über den Horizont hinauszublicken. Zumindest so weit, wie es einem halt möglich ist.
Denn Brauchtum, Traditionen und des Jägers viel geliebte Stille des Waldes. Das alles ist wichtig und erhaltenswert, dient aber vorerst nur einem selbst. Erst im Spiegelbild der Gesellschaft wird man sehen, ob das uralte Versprechen der Jagd an die Menschheit gehalten werden kann, in der Natur nicht nur ein schönes Schauspiel und keine reine Ressource zu sehen, sondern den Herzschlag, der alles Leben hervorbringt.
In diesem Sinn Weidmannsheil, euer Frechdachs

ZWISCHEN WEIDE UND WALD: Wie Rehe helfen könnten, Parasiten zu bremsen
TEXT UND GRAFIK: MAG. MED. VET. HELENA SEIBERL, MSC
FOTO: CH. BÖCK
Wer mit dem Fernglas über die morgendliche Wiese späht, hat meist anderes im Sinn als Würmer und Parasiten. Doch gerade dort, wo Rehwild und Weidetiere auf denselben Flächen unterwegs sind, spielt sich ein oft unsichtbares, aber entscheidendes Wechselspiel ab: Die Verbreitung von Magen-Darm-Parasiten.

EIN GEFÄHRLICHER WINZLING
Haemonchus contortus ist ein blutsaugender Parasit, der sich im Labmagen von Wiederkäuern ansiedelt – insbesondere bei Schafen und Ziegen, aber auch beim Rehwild. Vor allem bei Jungtieren kann ein Befall zu schweren Schäden führen: Blutarmut, Abmagerung, Leistungsabfall, im schlimmsten Fall sogar Verendung. Die wirtschaftlichen Schäden in der Nutztierhaltung sind enorm. Die Bekämpfung erfolgt in der Landwirtschaft durch regelmäßiges Entwurmen. Doch genau das hat Folgen: Mit der Zeit entwickeln sich resistente Parasitenstämme, gegen die herkömmliche Mittel kaum noch wirken. Das stellt Tierärztinnen und Tierärzte sowie Landwirtinnen und Landwirte – und letztlich auch Jägerinnen und Jäger – vor große Herausforderungen.
DAS REHWILD ALS JOKER?
Wildtiere, wie beispielsweise Rehe, dürfen und sollen, nicht zuletzt auch auf aktueller Empfehlung des Landesjagdverbandes, nicht entwurmt werden – und genau das könnte laut Forschung ein Vorteil sein. Denn dort, wo keine Medikamente zum Einsatz kommen, bleiben empfindliche Parasitenstämme bestehen. Tragen diese zur „Verdünnung“ resistenter Formen bei, sprechen Fachleute vom sogenannten „Refugium“, also einer Art natürlichem Schutzraum. Doch kann Rehwild wirklich eine solche Rolle spielen? Um das zu untersuchen, wurden 90 Rehe im Bezirk Kirchdorf an der Krems beprobt –mit tatkräftiger Unterstützung der Oberösterreichischen Jägerschaft. Aus dem Enddarm erlegter Stücke wurde Losung entnommen und im Labor auf Parasiten untersucht. Zum Vergleich wurden auch 20 Proben von Schaf- und Ziegenherden analysiert.
SPANNENDE ERGEBNISSE FÜR DIE JAGDPRAXIS
Die Untersuchung zeigte: Rehe sind häufig, aber meist schwächer befallen als kleine Hauswiederkäuer. Während 75 % der untersuchten Nutztiere mit dem Magenwurm infiziert waren, waren es beim Rehwild dennoch auch 62 %. Die Intensität des Befalls – gemessen an der Anzahl der Wurmeier pro Gramm Kot – war beim Rehwild im Mittel niedriger, allerdings mit hoher Streuung: Einzelne Rehe zeigten ebenfalls hohe Belastungen.
Der Anteil an resistenten Parasiten war beim Rehwild deutlich geringer. Während bei Schafen und Ziegen über drei Viertel der gefundenen Parasiten Anzeichen für Resistenz zeigten, lag dieser Wert beim Rehwild bei nur rund 11 %. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass Rehwild vor allem Parasiten beherbergt, die noch empfindlich auf gängige Entwurmungsmittel reagieren.
Einzelne Resistenzen konnten zwar auch beim Rehwild nachgewiesen
werden, allerdings in deutlich geringerer Ausprägung. Die genaue molekularbiologische Auswertung und Interpretation dieser Resistenzdaten wird derzeit im Detail wissenschaftlich aufbereitet und in einer Fachpublikation veröffentlicht. Und noch etwas fiel auf: Weder Alter noch Geschlecht noch die Nähe zu Nutztierweiden hatten einen signifikanten Einfluss auf den Parasitenbefall oder die Resistenzlage beim Rehwild.
WILDTIERE ALS NATÜRLICHER PARTNER IM PARASITENMANAGEMENT
Was bedeutet das nun für die Praxis? Rehwild ist offenbar kein Hauptverursacher, sondern eher ein stabilisierender Faktor im Krankheitsgeschehen. Die Tiere können zwar Parasiten aufnehmen und auch ausscheiden, da sie jedoch nicht entwurmt werden, beherbergen sie vor allem empfindliche Stämme. Genau diese könnten auf Wiesen und Weiden dabei helfen, das Überleben nicht-resistenter Parasiten zu sichern und damit die Wirksamkeit von Medikamenten in der Nutztierhaltung länger zu erhalten.
Dieses Zusammenspiel von Wild und Nutztier ist komplexer als gedacht –und zeigt, wie wichtig eine Zusammenarbeit von Jagd, Landwirtschaft und Forschung ist!
FAZIT FÜR DIE JÄGERSCHAFT
Die Ergebnisse sind ein weiteres Beispiel dafür, wie eng Wildtierökologie und Landwirtschaft miteinander verflochten sind. Sie zeigen, dass die Jagd nicht nur eine Aufgabe des Wildbestandsmanagements ist, sondern auch einen wertvollen Beitrag zur Tiergesundheit im weiteren Sinne leisten kann – nicht zuletzt auch durch die tatkräftige Unterstützung bei der gezielten Datenerhebung, regionaler Rückmeldungen und die Bereitstellung von Proben.
Zugleich verdeutlicht die Studie, dass pauschale Schuldzuweisungen – „die Wildtiere bringen Krankheiten!“ –
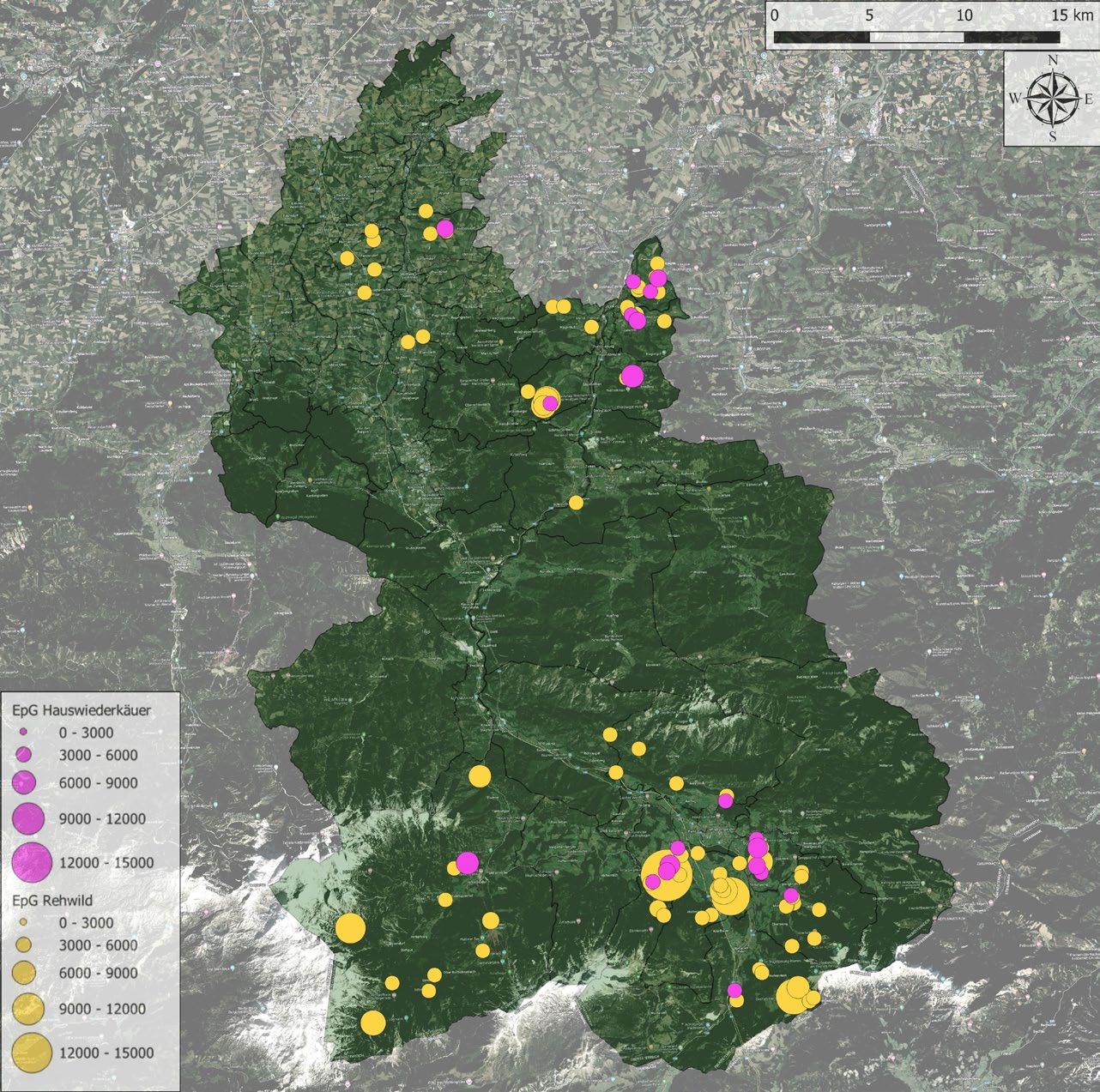
zu kurz greifen. In Wahrheit ist das Zusammenspiel zwischen Wild und Nutztier vielschichtig – und manchmal hilft gerade das Wild dabei, eine Balance zu erhalten.
Rehe als Helfer im Kampf gegen resistente Parasiten? Klingt zunächst ungewöhnlich – doch die Ergebnisse sprechen eine klare Sprache: Das Rehwild ist nicht nur Teil der Natur, sondern womöglich Teil der Lösung.
EIN HERZLICHES WEIDMANNSDANK AN DIE UNTERSTÜTZER
Ein besonderes Dankeschön gilt der örtlichen Jägerschaft im Bezirk Kirchdorf an der Krems, die bereitwillig und unkompliziert wichtige
Hintergrundinformationen sowie Proben bereitstellte. Ebenso bedanke ich mich bei den betroffenen Schaf-, und Ziegenbauern für die Teilnahme mit ihren Herden am Projekt. Für die finanzielle Unterstützung beim Oberösterreichischen Landesjagdverband, dem Tiergesundheitsdienst Oberösterreich (TGD OÖ) und der Veterinärmedizinischen Universität Wien, insbesondere beim Institut für Parasitologie für die organisatorische und wissenschaftliche Unterstützung, bedanke ich mich recht herzlich.
Ein besonderer Dank gilt Herrn OVR Univ. Doz. Dr. Armin Deutz, der diese Arbeit im Rahmen einer Master-
Die Karte zeigt die Belastung mit Magen-Darm-Strongyliden (gemessen in Eiern pro Gramm Kot – EpG) bei Hauswiederkäuern (Schafen und Ziegen, pink) und Rehwild (gelb) im Bezirk Kirchdorf an der Krems in Oberösterreich.
Die Größe der Kreise stellt den Schweregrad der Belastung dar –von geringer (0-3.000 EpG) bis sehr hoher Belastung (12.000-15.000 EpG).

arbeit fachlich begleitet und mit großem Engagement betreut hat. Solche interdisziplinären Forschungsprojekte sind nur möglich, wenn Jagd, Wissenschaft und Tiergesundheit/Landwirtschaft an einem Strang ziehen; diese Arbeit ist ein schönes Beispiel dafür.


DRAUSSEN IM REVIER

TEXT: BJM-STV. ING. ELFI MAYR, BEATE MOSER
FOTOS: R. HUFNAGL
Es gibt sie, die Topschützen mit Talent und konstanter Trefferquote. Gehören Sie zu dieser Spezies, ist dieser Artikel wahrscheinlich nichts für Sie. Anders, wenn Sie zu jenen Jungjägerinnen und Jungjägern gehören, die eher unsicher sind an der Wurftaube. Die zwar öfter trainieren wollen, aber dann dennoch immer eine kleine Ausrede parat haben, warum es gerade jetzt nicht passt. Und die sich –Hand aufs Herz – auch nicht 100-prozentig wohlfühlen, wenn -zig Blicke darauf achten, ob die beschossene Taube zerbröselt oder nicht.
Wir haben mit Elisabeth Hufnagl, Jägerin aus Stroheim (Bezirk Eferding) und erfolgreiche Sportschützin gesprochen. Sie gab uns einen ehrlichen, erfrischenden und motivierenden Einblick über ihre Anfänge, über ihre Entwicklung bis hin zu ihrer Teilnahme an internationalen Schießbewerben.
Geboren im Mühlviertel und geprägt vom Umfeld einer passionierten Jägerfamilie, war Elisabeth der Gedanke an die Jagd schon früh vertraut. Gemeinsam mit ihrer Schwester Ulrike sollte im Jahr 1999 die Jagdprüfung absolviert werden – ein hehres Vorhaben, das schließlich durch Studium und Beruf auf später verschoben wurde. 2011 absolvierte Elisabeth die Jagdprüfung. Und das sollte der Startschuss sein für ihre spätere Leidenschaft: das Wurftaubenschießen.
Man muss die Taube lesen lernen
„WARUM SCHIESST DU EIGENTLICH NICHT MIT?“ –DIE INITIALZÜNDUNG
Zunächst begleitete Elisabeth ihren Mann Ralf Hufnagl, selbst passionierter Jäger und Sportschütze, auf Bewerbe im In- und Ausland. Trug das Gewehr, verwaltete die Patronen und war seelische Unterstützung. Doch eines Tages kam die überraschende Frage: „Lisi, warum schießt du eigentlich nicht mit?“ Damals hätte sich Elisabeth Hufnagl nicht gedacht, dass sie jemals für den JSV Oberösterreich bei nationalen und internationalen Bewerben starten wird. Denn bei den Treibjagden ging es ihr durchwachsen, hatte zwar ihre Treffer, aber als gute Schützin hätte sie sich zu dem Zeitpunkt nicht bezeichnet. Es begann also zunächst mit einem leichten Zweifel. Bis sie ihre Entscheidung traf: Warum eigentlich nicht? Raus aus der Komfortzone! Was folgte, war der klassische Einstieg über das Bezirks- und Landesschießen, und dann ging es Schlag auf Schlag: Elisabeth, längst Mitglied im Jagd- und Wurfscheibenclub Ansfelden (der leider zwischenzeitlich aus genehmigungstechnischen Gründen aufgelöst wurde), bewies Talent, Biss und den nötigen Sportsgeist.
TRAINING, TECHNIK & TAUBEN: DER WEG ZUM ERFOLG
Professionelle Einzeleinheiten mit renommierten Trainern, wie unter anderem Staatsmeister Josef Melcher, legten das Fundament, darauf baute Elisabeth mit Ausdauer und gezieltem Üben auf. Denn die Disziplin „Jagdparcours“ oder „Compak“ nach FITASC-Reglement, ist
nichts für Hobbyisten mit Sonntagsambitionen. Jede Wurftaube fliegt anders, jeder Ablauf muss sitzen. Schießsport ist kein Glücksspiel, sondern eine Gleichung aus Planung, Konzentration und zugegeben auch ein bisschen Bauchgefühl. Dabei ist nicht nur der Kopf gefragt. Auch Arme, Schultern und Rumpf wollen trainiert sein. Am Anfang kostet das Schießen Kraft, blaue Flecken an der Schulter inklusive. Wie bei jeder Sportart heißt es durchhalten. Und sich nicht irritieren lassen.
Wir fragen nach, ob Männer denn tatsächlich mit der Flinte besser schießen als Frauen. „Die Kraft betreffend tun sich Männer im ersten Augenblick sicher leichter. Als Frau sollte man sich daher anfangs nicht zu sehr mit den männlichen Kollegen vergleichen. Vielmehr geht es darum, wie bei jeder Sportart seine eigenen Voraussetzungen zu kennen und dementsprechend zu trainieren. Übrigens, wer den Damen bei der Weltmeisterschaft zusieht, wird nicht mehr hinterfragen, ob Frauen weniger gut schießen. Es geht darum, seinen eigenen Stil bzw. Weg zu finden. Das gilt für Schützinnen und Schützen gleichermaßen“, erklärt uns Elisabeth.
Ein entscheidender Erfolgsfaktor beim Wurftaubenschießen ist die richtige Technik – dazu zählen eine stabile Schießhaltung, präzises Zielen und das gleichmäßige Mitschwingen mit der Wurftaube.
„Du musst immer vor der Taube sein – je nach Distanz und Geschwindigkeit“, hört man am Schießstand immer wieder von den erfahrenen Schützen. Das sei der Schlüssel zum
Erfolg, erklärt uns Elisabeth. Doch für sie war diese Aussage zunächst zu abstrakt.
Erst als der Schießtrainer sie fragte, ob es einfacher wäre, wenn das Vorhaltemaß in Metern oder in Zentimetern relativ zum Sichtfeld – also dem

Elisabeth Hufnagl
Abstand zwischen Korn und Taube erklärt werde, wurde es für sie greifbarer. Und genau das war für sie der Durchbruch.
Wir sind neugierig, und wollen wissen, ob Mentaltraining bei den Profischützen ein Thema ist. „Auf alle Fälle, selbst absolute Top-Schützinnen und Top-Schützen können nervös werden, wenn die Blicke anderer Profis auf sie gerichtet sind. Mentalcoaching hilft, Nervosität und Unbehagen zu verringern. Visualisierungstechniken, um den Schießablauf, welchen man sich im Zuge des Trainings aufgebaut hat, abzurufen, und durch Erfolg den nötigen Spaß an der Taube zu entwickeln. Das ist mentale Stärke. Und es muss ja nicht immer um den Bewerb gehen. Diese mentale Stärke kann man auch gut trainieren, wenn man zum Beispiel mit den eigenen Jagdkollegen am Schießstand ist. Einfach mal ausprobieren, nachher ist man froh, es versucht zu haben. Der Erfolg gibt einem Recht.
Um gut und konstant treffen zu können, muss das Gewehr zu 100 % passen. Dazu soll beim Kauf der Flinte auf die Beratung des Profis, des Trainers oder des Waffenhändlers gesetzt werden. Die Munition betreffend ist Elisabeth wichtig, immer dasselbe Fabrikat zu verwenden, keine Experimente einzugehen. Manche Schießstände schreiben die Verwendung von bestimmten Arten von Munition vor: Subsonic oder nicht, Blei oder bleifrei, die Vorgaben sind im Regelfall auf der jeweiligen Betreiber-Homepage ersichtlich.
Auch zu Hause kann man im Trockentraining an der Technik feilen. Elisabeth empfiehlt, das Gewehr (entladen, versteht sich!) aus dem Schrank zu nehmen und auf einen vorher fixierten Punkt im Raum den Anschlag dynamisch hin zu üben. Auch das Entlangvisieren an einer Längslinie, zum Beispiel entlang einer Gardinenschiene, verbessert die Zielsicherheit.
JAGDPARCOURS UND TREIBJAGD
Am Ende unseres Gesprächs wollten wir wissen, ob man automatisch auch bei den Treibjagden eine Meisterschützin oder ein Meisterschütze ist, wenn man so oft am Schießstand trainiert. Elisabeths Antwort: „Natürlich wird man etwas sicherer und für die bevorstehenden Treibjagden ist es auch wichtig zu üben, aber am Parcours lernt man jede einzelne Taube lesen, schießt sie mitunter oftmals hintereinander, um sie konstant und sicher zu treffen. Diese Chance hat man in der Natur nicht. Während man die Wurftaube lesen lernt, ist das Wild frei in der Bewegung, und dadurch schwerer einschätzbar.
Liebe Elisabeth, danke für deine Bereitschaft und deine Offenheit. Wir wünschen dir weiterhin gute Erfolge bei den bevorstehenden Bewerben.

WURFSCHEIBENSCHIESSEN DISZIPLINEN:
• Trap: Die Wurfscheiben werden von einem Wurfautomat vor der Schützenposition weg in zufälligen Richtungen und Höhen geworfen.
• Skeet: Eine Skeetanlage besteht aus zwei Wurfmaschinen, die Häuser stehen sich gegenüber Die Wurfscheiben werden in festgelegten Bahnen geworfen. Eine Wurfmaschine bildet das so genannte Hochhaus (circa drei Meter über dem Boden) und eine das so genannte Niederhaus (circa einen Meter über dem Boden), dahinter sind im Halbkreis zwischen den Häusern die Stände angeordnet
• Jagdparcours: Eine Disziplin, die das Verhalten von Niederwild simuliert und dadurch die wesentlich realistischere Situation von Jägern abbildet. Wegen der vielen Varianten von Flugbahnen, Geschwindigkeiten und Höhen beim Jagdparcours ist die Disziplin eine gute Vorbereitung für die Niederwildjagden, sie ist jedoch nicht olympisch.
• Compak-Sporting: Eine relativ neue und kompaktere Form des Jagdparcours, die auf kleineren Schießständen geschossen werden kann. Die Schützen schießen dabei aus Käfigen, die Wurfscheiben können, wie beim Jagdparcours, als Einzeltauben oder Doubletten aus allen Richtungen kommen. Neben Standardtauben kommen auch Varianten wie Mini, Segel oder Rollhasen zum Einsatz.
• Helice-ZZ: Wenig verbreitete Disziplin, bei der nicht auf Tontauben, sondern auf „Elektrotauben“ geschossen wird. Diese Tauben sind aus Plastik und haben einen Propeller, welcher die Flugbahn unvorhersehbar macht und sie sogar die Richtung wechseln lässt.
CHOKES
Chokes sind Einsätze im Lauf einer Flinte, die bestimmen, wie stark sich die Schrotgabe nach dem Mündungsaustritt in Abhängigkeit auf die Entfernung verteilt.
• Weit entferntes Ziel: Enge Streuung, also enger Choke
• Nahes Ziel: Weitere Streuung, also weiter Choke
Auf die Frage nach dem richtigen Choke gibt es keine eindeutige Antwort, aber es helfen Richtwerte, an denen man sich orientieren kann. Im Versuch auf eine Anschusstafel lässt sich nachvollziehen, wie sich die Schrotgabe auf bestimme Entfernungen verhält.
• Skeet: sehr offen, z. B. Skeet-Choke oder 1/4
• Trap: 3/4 – 1/1 (voll)
• Jagdparcours: 1/2 und 1/1 (voll)
Innen oder außen?
• Innenliegende Chokes: bündig mit dem Lauf, meist Werkzeug zum Entfernen/Wechseln nötig
• Externe Chokes: ragen etwas aus dem Lauf, oft ohne Werkzeug wechselbar und schützen die Laufmündung
Wichtige Hinweise
• Chokes regelmäßig reinigen und leicht fetten – sonst rosten sie fest
• Nicht alle Chokes sind für „Stahlschrot“ zugelassen
• Für „Stahlschrot“ lieber etwas weiter wählen – da es enger streut
i
WEITERE INFORMATIONEN
Eine Übersicht über die Wurfscheiben-Anlagen in Oberösterreich und deren Öffnungszeiten gibt es auf der Homepage des OÖ. Landesjagdverbandes: www.ooeljv.at
OÖ. WEISER- UND VERGLEICHSFLÄCHENBEURTEILUNGEN 2025
Die Auswertungen der Vegetationsbeurteilungen 2025 in Oberösterreich zeigen durchwegs gute bis sehr gute Ergebnisse. Grund dafür dürfte zum einen die konsequente Bejagung und zum anderen der milde Winter gewesen sein.
Im Detail bedeutet das, dass bei den Vegetationsbeurteilungen im Frühjahr 2025 insgesamt 421 Jagdgebiete begangen und bewertet worden sind. Davon entfielen 383 Jagden oder etwa 91 % in Stufe I und wiesen demnach eine tragbare bis überwiegend tragbare Verbissbelastung auf. Bei 35 Jagdgebieten oder etwa 9 % wurden diese als zu hoch (Stufe II) beurteilt. Eine Beurteilung der Stufe III, nicht tragbarer Zustand der Verjüngung, wurde in keinem Bezirk vorgefunden.
436 Jagdgebiete werden der Beurteilungsstufe „Nachhaltige Ier Jagd“ zu-
geteilt und wurden daher im Frühjahr 2025 nicht begangen.
DI
Marcus Stefsky, Landesforstdienst OÖ
Vegetationsbeurteilung 2025 Ergebnisse nach Bezirken
EPIGENETIK BEI WILDTIEREN
TEXT: PAMELA BURGER UND CLAUDIA BIEBER FORSCHUNGSINSTITUT FÜR WILDTIERKUNDE UND ÖKOLOGIE, VETMEDUNI, WIEN
FOTO: CH. BÖCK, GRAFIK: WIKIPEDIA
„Nicht nur die Umweltbedingungen des einzelnen Individuums spielen eine Rolle, sondern auch die Erfahrungen und Einflüsse der Eltern und Großeltern sind wichtig für die individuelle Entwicklung.“

Was bringt die Zukunft für diese jungen Graugänse? Nicht nur die „Qualität“ der Gene zählt, sondern auch die Umwelt, in der sich Lebewesen entwickeln – dies über Generationen hinweg.
ANPASSUNG AN DIE UMWELT
Eine möglichst rasche Anpassung an sich verändernde Umweltbedingungen sichert das Überleben von Wildtierpopulationen. Für solche Anpassungen haben Wildtiere ein Repertoire an biologischen Mechanismen zur Verfügung. Sie verändern, je
nach Umfeld in dem sie Leben, zum Beispiel ihr Aussehen, unter anderem die Fellfarbe oder Größe der Ohren, oder sie passen ihr Verhalten bei der Futtersuche an. In sehr heißen Lebensräumen haben z.B. Fuchsartige große Ohren und lange Beine, der Polarfuchs lebt in der Kälte und
hat kleine Ohren und kurze Beine. Je größer die Oberfläche eines Tieres, umso mehr der Körperwärme kann abgegeben werden. In der Wüste ist das lebenswichtig, im hohen Norden eine Lebensbedrohung. Immerhin muss ein Säugetier zur optimalen Funktion immer in einem schmalen
Fenster der optimalen Körpertemperatur liegen. Es haben also Anpassungen stattgefunden, die die Wärme der Umgebung berücksichtigen. Die Grundlagen für Biodiversität und somit zur Anpassungsfähigkeit von Wildtieren finden wir in ihrem Erbmaterial, der sogenannten DNA (Desoxiribunucleinacid, deutsch -säure). Nach der Entdeckung ihres Aufbaus durch Watson & Crick in den 50er Jahren, war sich die Wissenschaft sicher, den Schlüssel für Vererbung von Körpermerkmalen und teilweise auch Verhalten gefunden zu haben. Neue Forschungsergebnisse zeigen jedoch, dass die Vererbung von Merkmalen komplexer ist als bisher vermutet. So wird die Vielfalt in einer Population nicht nur von ihrem Erbgut (DNA), also ihrer Genetik bestimmt, sondern auch von anderen Faktoren, der sogenannten Epigenetik. Der Wortstamm „Epi“ kommt aus
dem Griechischen und bedeutet „darüber hinaus“. Die Epigenetik untersucht demnach alle weiteren, nicht die DNA verändernden Faktoren, welche nicht die Abfolge ihrer Sequenz, sondern die Aktivität unserer Gene und somit die Entwicklung der Zellen über einen gewissen Zeitraum bestimmen.
VERERBUNG
Die DNA, also unser Erbgut, besteht aus vier Grundbausteinen: Adenin (A), Thymin (T), Cytosin (C) und Guanin (G). Diese Bausteine können paarweise, als Basenpaare (A-T und C-G), in unterschiedlichen Abfolgen aneinandergereiht werden und bieten einen unerschöpflichen Pool an Kombinationsmöglichkeiten. Immer ein bestimmter Abschnitt der DNA ist für die Ausprägung eines Merkmals verantwortlich, das sogenannte Gen. Die Anzahl dieser Basenpaare
und Gene und damit das gesamte Erbgut eines Lebewesens ist so groß, dass die komplette Entschlüsselung z.B. für die DNA des Menschen erst 2021 im Rahmen des „Humangenomprojekts“ gelang. Das Ergebnis zeigt, dass wir die genaue Abfolge von etwa 3 Milliarden Basenpaaren, welche die Grundlage für 19.969 Gene liefern, jetzt exakt kennen. Unglaublich viel Information ist also in jeder einzelnen Zelle unseres Körpers gespeichert – moderne Speicherplatten fallen da in dem Vergleich Leistung/ Größe weit zurück.
Was aber bedeutet diese ganze Information für uns? Heute wissen wir, dass nicht alle Information gleichermaßen aktiv ist oder zur Entwicklung beiträgt. Große Teile sind inaktiv, sozusagen ausgeschaltet. Und hier kommt jetzt die Epigenetik ins Spiel. Da Änderung der DNA Sequenz auf Zufällen in der Abfolge

der Basenpaare beruht (z.B. sogenannte Mutationen), sind neue Baupläne relativ selten. Immerhin gibt es viele Kontrollmechanismen die Fehler ausmerzen. Zuviel hängt für die Gesundheit des Lebewesens davon ab. Eine schnelle Anpassung ist damit schwierig. Lediglich eine Neukombination, indem es zur Paarung, also zu Vermischung von elterlichem Erbgut beim Nachwuchs kommt, bietet größeren Raum für Veränderungen im Erbgut und damit für Anpassungen an den Lebensraum. Bei kurzfristigen Veränderungen reicht aber auch diese Trickkiste der Evolution, die Zeugung von Nachwuchs, anscheinend nicht aus und hier setzt die Epigenetik an.
EPIGENETIK UND DER MENSCH
Ein sehr bekanntes Beispiel für die Wirkung der Epigenetik finden wir im Menschen selber – leider in einer extrem traurigen und belastenden Situation. So wurde die Bevölkerung im „Dutch hunger“ (Niederländischen Hunger) unter dem Terror des
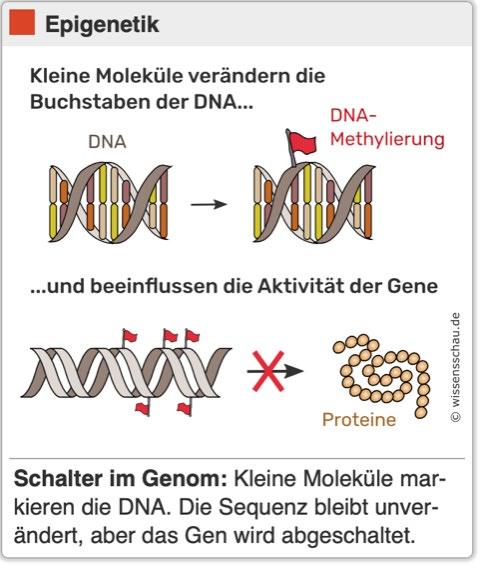
deutschen Naziregimes im Winter 1944 in eine katastrophale Hungersituation gezwungen. Der Krieg war eigentlich verloren, trotzdem wurden alle Nahrungstransporte in die Niederlande blockiert. Wissenschaftler und Medizinier untersuchten in den folgenden Jahrzehnten die traurige
Auswirkung dieser menschenverachtenden Geschehnisse.
Es stellte ich heraus, dass Kinder von Frauen, die diesen Hunger während der Schwangerschaft erlebten, besondere Merkmale zeigten. So hatten die Kinder später als Erwachsene signifikant öfter Übergewicht und Diabetes als ihre Geschwister, in deren Schwangerschaft die Mutter keinen Hunger leiden musste. Wie kann das sein, da das Erbgut also die DNA diese Veränderung der verwandten Geschwister nicht erklären konnte? Es zeigte sich, dass die Menschen, die unter diesen Umständen ausgetragen wurden, bestimmte Gene, die für den Stoffwechsel verantwortlich waren, an- bzw. ausgeschaltet hatten. Man kann sich das folgendermaßen vorstellen: Die DNA liefert die Hardware, die Epigenetik die Software. Bestimmte Moleküle – sog. Methylgruppen – legen sich dabei an die Gene und beeinflussen ihre Wirkung. Methylierungen an den Genen, das ist der wichtigste Teil der Epigenetik. Diese Methylierung sorgt dafür, dass sich Personen mit identischen Genen unterschiedlich entwickeln. Epigenetik kann also sehr kurzfristig das Erbgut gezielt beeinflussen und so zu Anpassungen führen. Im Falle des oben genannten Beispiels wurden die Nachkommen sozusagen stoffwechseltechnisch auf eine zu erwartende Mangelversorgung ausgerichtet.
EPIGENETIK UND WILDTIERE
Studien in verschiedenen Wildtierpopulationen zeigten, dass epigenetische Veränderungen bei Anpassung an Temperatur und an unterschiedliche Habitate auftraten (Hu & Barrett 2017). Ernährungsdefizite und verschiedene Umweltschadstoffe, vor allem in frühen Entwicklungsphasen (s.o.), können epigenetische Veränderungen bewirken, die mit einem Krankheitsrisiko einhergehen. Ein Beispiel wie Ernährung als epigenetischer Faktor wirkt, wurde bei zwei Populationen von Weiß-
wedelhirschen in Mississippi in den USA gezeigt. Während die eine Gruppe ein signifikant geringes Gewicht und kleinere Geweihe hatte, zeigt die andere Gruppe diese Veränderungen nicht, obwohl keine genetischen Unterschiede gefunden wurden. Über Generationen hinweg lebte die „körperlich kleinere“ Gruppe in einer Region mit geringerem Nahrungsangebot, wobei die Gene für ein größeres Geweih- und Körperwachstum zeitweise „abgeschaltet“ wurden. Dies, da kleinere Weißwedelhirsche in dieser Umwelt mit weniger Futter einen Vorteil hatten. Dieses Ausschalten von Genen verhinderte, dass Hirsche zu groß wurden und mit dem geringeren Nahrungsangebot nicht mehr zurechtgekommen wären. Hier kommt eine weitere Besonderheit der Epigenetik zum Tragen. Bisher wurde vermutet, dass nur was in der DNA festgeschrieben steht von Generation zu Generation vererbt werden kann. Auch die epigenetischen Veränderungen können, wie man heute weiß, an die Nachkommen weitergegeben werden. Diese neue Erkenntnis hat weitreichende Konsequenzen. Nicht nur die „Qualität“ der Gene zählt, sondern auch die Umwelt, in der sich Lebewesen entwickeln – dies über Generationen hinweg. Heute weiß man von Wirkungen über maximal drei Generationen, dann verschwinden die Methylierungen wieder, das System bleibt so flexibel. Epigenetik zeigt uns, dass nicht nur die Umweltbedingungen des einzelnen Individuums eine Rolle spielen, sondern auch die Erfahrungen und Einflüsse der Eltern und Großeltern wichtig für die individuelle Entwicklung sind.
Ebenso können Temperaturveränderungen und Stress epigenetische Mechanismen beeinflussen, die wiederum das soziale Verhalten bei Säugetieren verändern können. Dies wurde am Beispiel von Meerschweinchen, Steppenpavianen, und Tüpfelhyänen untersucht (Guerrero et al. 2020). Vergleichbare Studien bei Schalenwild fehlen jedoch bisher.
ALTERSBESTIMMUNG
UND EPIGENETIK
Eine der neuesten Entwicklungen im Wildtiermanagement ist die Nutzung von epigenetischer Information für die Altersbestimmung einer Wildpopulation, die sogenannte „epigenetische Uhr“. Dafür wurden in einer Studie die Muster in der DNA-Methylierung bei Rehen bestimmt und mit dem tatsächlichen, also chronologischen, Alter verglichen und eine starke Korrelation festgestellt (Lemaitre et al. 2022). Auch bei Schwarzbären, Bergziegen und Weißwedelhirschen konnte kürzlich anhand spezies-spezifischer epigenetischer Muster das epigenetische Alter bestimmt werden (Czajka et al. 2024). Aber was bedeutet das nun tatsächlich? Die Altersbestimmung mittels epigenetischer Uhr birgt eine Anzahl an Vorteilen gegenüber herkömmlichen Methoden wie z.B. der post mortem Zahnschliff. DNA und damit auch epigenetische Information, kann aus den verschiedensten, einfach zu bekommenden Probenmaterialien, wie Haarwurzeln oder Kotproben gewonnen werden. Das Tier muss dazu nicht getötet werden, bzw. Blut- oder Gewebeentnahmen ertragen. Mit auf die Art abgestimmten epigenetischen Marken ist somit ein umfassendes Monitoring der Altersverteilung in einer Wildtierpopulation möglich.
REFERENZEN
Czajka N, Northrup JM, Jones MJ, Shafer ABA (2024) Epigenetic clocks, sex markers and age-class diagnostics in three harvested large mammals. Mol Ecol Resour. 2024;24:e13956. DOI: 10.1111/17550998.13956
Tania P Guerrero, Jörns Fickel, Sarah Benhaiem, Alexandra Weyrich, Epigenomics and gene regulation in mammalian social systems, Current Zoology, Volume 66, Issue 3, June 2020, Pages 307–319, https://doi. org/10.1093/cz/zoaa005
Hu J, Barrett RDH. Epigenetics in natural animal populations. J Evol Biol. 2017 Sep;30(9):1612-1632. doi: 10.1111/jeb.13130. Epub 2017 Jul 20. Erratum in: J Evol Biol. 2017 Dec;30(12):2258. doi: 10.1111/jeb.13216.
Lemaître JF, Rey B, Gaillard JM, Régis C, Gilot-Fromont E, Débias F, Duhayer J, Pardonnet S, Pellerin M, Haghani A, Zoller JA, Li CZ, Horvath S. DNA methylation as a tool to explore ageing in wild roe deer populations. Mol Ecol Resour. 2022 Apr;22(3):1002-1015. doi: 10.1111/1755-0998.13533.
Michel, E., S. Demarais, B. Strickland, A. Blaylock, W. McKinley, C. Dacus, and B. Hamrick. 2017. The Role of Genetics and Nutrition in Deer Management. Mississippi State University Extension Service Publication 3013.
Carlberg C, Mohar F (2023) Epigenetik des Menschen: How Science Works, Springer Spektrum. ISBN 978-3031332883.
Am FIWI ist die epigenetische Forschung angekommen (Klughammer et al. 2023). In dem vorliegenden Artikel, der das ganze Forschungsfeld natürlich nur anreißen kann, möchten wir darauf aufmerksam machen. Da die Aufarbeitung der Proben im Labor aufwändig ist, benötigen wir hier Fördermittel, die wir im Bereich der Grundlagenforschung beantragen. Wir hoffen, daraus ein tieferes Verständnis der Epigenetik bei Wildtieren zu erhalten und dies zukünftig auch in Managementempfehlungen umsetzen zu können.
Klughammer J, Romanovskaia D, Nemc A, Posautz A, Seid CA, Schuster LC, Keinath MC, Lugo Ramos JS, Kosack L, Evankow A, Printz D, Kirchberger S, Ergüner B, Datlinger P, Fortelny N, Schmidl C, Farlik M, Skjærven K, Bergthaler A, Liedvogel M, Thaller D, Burger PA, Hermann M, Distel M, Distel DL, KübberHeiss A, Bock C. Comparative analysis of genome-scale, baseresolution DNA methylation profiles across 580 animal species. Nat Commun. 2023 Jan 16;14(1):232. doi: 10.1038/ s41467-022-34828-y.

Was wollten Sie schon immer über die Jagd wissen? fragen-zur-jagd.at
GRAUGANS IM FOKUS
Bestandsentwicklung und jagdliche Maßnahmen

DIE GRAUGANS – VOM ZUGVOGEL ZUM BESTÄNDIGEN VOGEL IN OBERÖSTERREICH
Noch vor mehr als zwei Jahrzehnten galt die Graugans (Anser anser) in Oberösterreich als unauffälliger Zugvogel mit geringer jagdlicher Bedeutung. Heute hat sich das Bild gewandelt: Die Art ist in vielen Regionen des Landes – insbesondere entlang der großen Flüsse im Innviertel, im Zentralraum sowie im Mühlviertel –
sesshaft geworden und nutzt unsere Kulturlandschaft intensiv.
Auf Grund geeigneter Brut- und Nahrungsbedingungen steigen die Bestände kontinuierlich an. Diese Entwicklung geht jedoch zunehmend mit Konflikten einher: Fraßschäden auf Feldern und Verschmutzungen auf Liegewiesen in Seenähe sorgen für wachsenden Handlungsbedarf. Abschusszahlen steigen deutlich Der Bestandstrend der Graugans
spiegelt sich auch in den jagdlichen Streckenzahlen wider. Während im Jahr 2003 lediglich 45 Stück in Oberösterreich erlegt wurden, lag die Zahl im Jahr 2024 bereits bei 230 Stück (siehe Grafik).
BEJAGUNGSZEITRAUM
Insbesondere im diesjährigen Herbst ist es nun wichtig die stark im Steigen begriffenen Bestände der Graugänse in OÖ wieder zu reduzieren.
Foto: © Getty Images
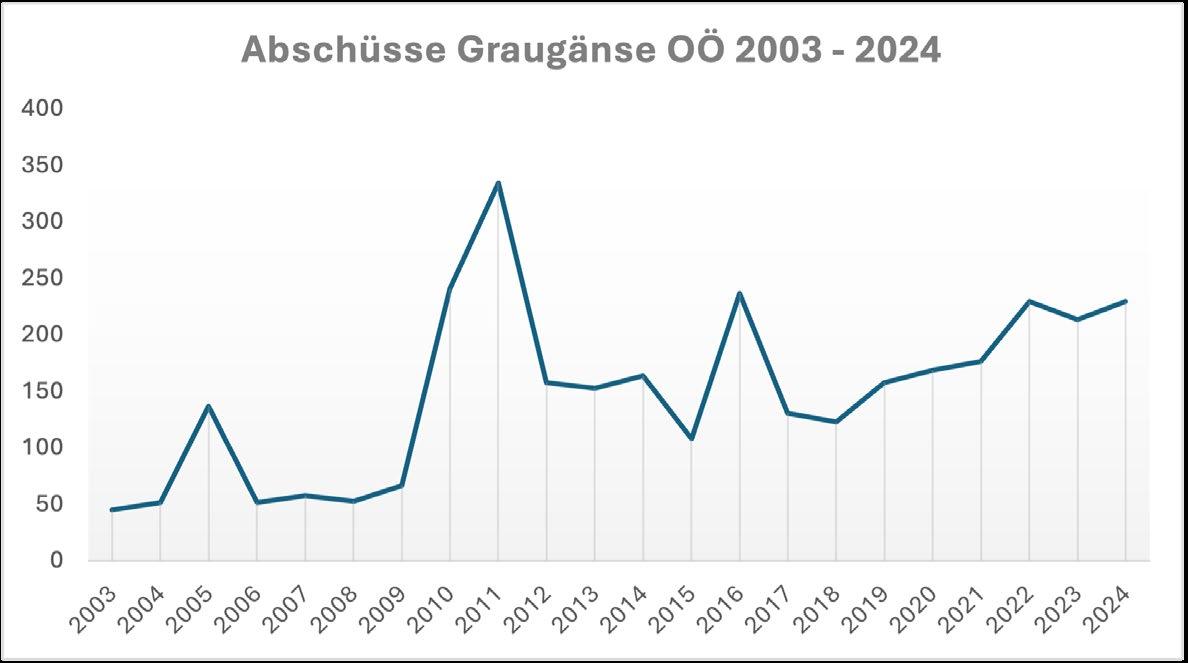
Die reguläre Schusszeit dauert von 1. August bis 31. Jänner. Zusätzlich können nun auch während der Schonzeit der Graugans (1. Februar bis 31. Juli) gezielte Maßnahmen auf Grundlage der neuen Oö. Federwildmanage-
mentverordnung gesetzt werden. Wissen erweitern: Schulungen und Informationsveranstaltungen
Zur Unterstützung der Jägerschaft sind im Herbst 2025 folgende Veranstaltungen geplant:
• Schulungskurse zur letalen Entnahme im Rahmen der Oö. FMVO
• Informationsveranstaltungen zur effektiven Bejagung und Vergrämung von Graugänsen


Die genauen Termine und Anmeldemöglichkeiten werden rechtzeitig über den Oö Landesjagdverband bekannt gegeben.
i

WEITERE INFORMATIONEN
Aktuelle Informationen, rechtliche Grundlagen sowie Entnahmeformulare zur Oö. FMVO finden Sie auf der offiziellen Internetseite des Landes Oberösterreich: www.land-oberösterreich.gv.at/ 541473.htm





EUROPA UND DER WOLF: Zwischen Schutz und Herausforderung
TEXT: MAG. BENJAMIN ÖLLINGER
Die Ausbreitung der Wölfe in unserer Europäischen Kulturlandschaft berührt vorrangig zwei Interessenlagen, jene des großen Beutegreifers1 und jene von uns Menschen. Durch die hohen Wachstumsraten der Europäischen Wolfspopulationen in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten wurden bzw. sind in vielen Europäischen Staaten notwendigerweise Wolfsmanagementmaßnahmen umgesetzt und eingeführt worden. Die nunmehrige Änderung des Schutzstatus in der Berner Konvention und anschließend in der FaunaFlora-Habitatrichtlinie (FFH-Richtlinie) ermöglicht den Mitgliedstaaten – unter bestimmten Voraussetzungen – seit Sommer 2025 mehr rechtlichen Spielraum beim Umgang mit dieser Wildtierart.
BIOLOGIE UND VERBREITUNG
Nicht nur biologisch gesehen nehmen Wölfe und damit auch der Eurasische Wolf (Canis lupus lupus) eine besondere Stellung ein. Sie sind an sich eine Unterart der in Europa vorkommenden Art des Wolfs (Canis
lupus). Als weitgehend unbestrittene Basis ist davon auszugehen, dass wir es in Europa überwiegend mit dem Eurasischen Wolf zu tun haben. Wolfsforscher:innen sind sich jedoch weitgehend einig darüber, dass es im Norden des Europäischen Kon-
tinents mit dem Canis lupus albus (sog. Tundrawolf, ua. Verbreitung von Finnland über den nördlichen Teil Russlands bis nach Kamtschatka) und süd- bzw. südöstlich angrenzend mit dem Canis lupus campestris (Kaspischer Wolf, ua. Verbreitung
1 In Europa kommen sechs große Beutegreiferarten vor: Braunbär (Ursus arctos), Wolf (Canis lupus), Eurasischer Luchs (Lynx lynx), Iberischer Luchs (Lynx pardina), Vielfraß (Gulo gulo) und Goldschakal (Canis aureus)
Fotos: Getty Images, Shutterstock
von Rumänien über den südlichen Teil Russlands über Kasachstan bis in den Iran) teilweise zu Populationsüberschneidungen kommt. Überwiegend kommen auf dem Europäischen Kontinent Subpopulationen des Eurasischen Wolfes vor. Diese Metapopulation lässt sich in 1. eine skandinavische, 2. eine karelische, 3. eine baltische, 4. eine karpatische, 5. eine dinarisch-balkanische, 6. eine iberische, 7. eine italienische, eine 8. alpine und schließlich 9. in eine mitteleuropäische Flachlandpopulation (bzw. deutsch-westpolnische Population) mit unterschiedlichen Genotypen und Haplotypen unterteilen.
Im Dezember 2023 veröffentliche die Europäische Kommission einen umfassenden Bericht zur Situation der Wolfspopulation(en) in Europa unter
anderem in Bezug auf Gesamtanzahl, Steigerungsrate und der wachsenden Verbreitung in den Europäischen Ländern. Festgehalten wurde, dass die jeweilige Wolfspopulation bei nahezu allen Subpopulationen stabil ist oder zunimmt. Der festgestellte Gesamtanstieg ist vor allem auf die schnell wachsende Wolfspopulation in Mitteleuropa und den Alpen zurückzuführen. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre aus den Alpenländern Italien, Frankreich (und der Schweiz) zeigen, dass die (Wieder) Besiedlung einer Region durch den Wolf in drei Phasen erfolgt:
PHASE 1
Einwanderung von einzelnen jungen Männchen; die Tiere ziehen vorerst weit umher; wo sie genug Nahrung vorfinden, werden sie stationär;

PHASE 2
Einwanderung von jungen Wölfinnen; die Paarbildung und Reproduktion in kleinen Familienrudeln beginnt meist in wild- und waldreichen, ruhigen Gebieten;
PHASE 3
Flächige Ausbreitung und regelmässige Reproduktion, die zu einem Populationszuwachs von 20 – 30 % jährlich führen kann
RECHTLICHER RAHMEN
Bis zum Sommer 2025 war der Wolf in Europa teilweise in Anhang IV (Schutzstatus: streng geschützt) und in Anhang V (Schutzstatus: geschützt) der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen

Verbreitung der Wölfe in Europa für den Zeitraum 2017-2022/23 aus Kaczensky, P., Ranc, N., Hatlauf, J., Payne, J.C. et al. 2024. Large carnivore distribution maps and population updates 2017 – 2022/23. Report to the European Comission under contract N° 09.0201/2023/907799/SER/ENV.D.3 “Support for Coexistence with Large Carnivores”, “B.4 Update of the distribution maps”. IUCN/SSC Large Carnivore Initiative for Europe (LCIE) and Istituto di Ecologia Applicata (IEA), S. 34 und 35
Europa und der Wolf: Zwischen Schutz und Herausforderung
Anhang IV
Wolf (ausgenommen die griechischen Populationen nördlich des 39. Breitengrades; die estnischen Populationen, die spanischen Populationen nördlich des Duero; die bulgarischen, lettischen, litauischen, polnischen, slowakischen Populationen und die finnischen Populationen innerhalb des Rentierhaltungsareals im Sinn von Paragraf 2 des finnischen Gesetzes Nr. 848/90 vom 14. September 1990 über die Rentierhaltung);
Anhang V
Wolf (spanische Populationen nördlich des Duero, griechische Populationen nördlich des 39. Breitengrades; finnische Populationen innerhalb des Rentierhaltungsareals im Sinn von Paragraf 2 des finnischen Gesetzes Nr. 848/90 vom 14. September 1990 über die Rentierhaltung, bulgarische, lettische, litauische, estnische, polnische und slowakische Populationen).
Hintergrund für diese unionsrechtliche Einteilung waren der (damalige) Verbreitungszustand und der günstige Erhaltungszustand der (damaligen) Subpopulationen, aber auch bestimmte Vorbehalte von Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer jeweiligen (damaligen) Beitrittsverhandlungen zur Europäischen Union. Auf der Grundlage der bereits zuvor erwähnten eingehehenden Analyse des Status des Wolfes in der Europäischen Union wurde im Dezember 2024 zunächst der Schutzstatus in der Ber-

ner Konvention geändert. In weiterer Folge wurde auch die FFH-Richtlinie diesbezüglich angepasst.
Mit der Richtlinie (EU) 2025/1237 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 2025 wurde für die Wildtierart Wolf der Eintrag in Anhang IV zu Gänze gestrichen und vollständig und umfassend in Anhang V übernommen. Veröffentlicht wurde diese Änderung am 24. Juni 2025 und ist damit seit 14. Juli 2025 gültig. Dies bedeutet, dass der Wolf in allen EU-Mitgliedstaaten dem Anhang V unterliegt. Somit gilt der Wolf nunmehr nicht mehr als streng geschützte Tierart von gemeinschaftlichem Interesse. Bei geschützten Tierarten von gemeinschaftlichem Interesse kann, sofern es für erforderlich erachtet wird, die Entnahme von Exemplaren aus der Natur und deren Nutzung nunmehr Gegenstand von notwendigen (Verwaltungs) Maßnahmen gemäß Artikel 14 2 der FFH-Richtlinie sein. Die bisherige
2 Derartige Maßnahmen können, wenn sie von einem Mitgliedstaat aufgrund der Überwachung gemäß Art. 11 FFH-Richtlinie für erforderlich erachtet werden, zB folgendes umfassen: 1. das zeitlich oder örtlich begrenzte Verbot der Entnahme von Exemplaren aus der Natur und der Nutzung bestimmter Populationen, 2. die Regelung von Entnahmeperioden und/oder -formen, 3. die Beurteilung der Auswirkungen der ergriffenen Maßnahmen usw.;
3 „Favourable Conservation Status“ (FCS): Der Erhaltungszustand von Wölfen wird dann als günstig bezeichnet, wenn aufgrund der Daten über die Populationsdynamik anzunehmen ist, dass diese Art ein lebensfähiges Element des natürlichen Lebensraumes bildet und langristig bilden wird, das natürliche Verbreitungsgebiet dieser Art weder abnimmt noch in abnehmbarer Zeit abnehmen wird und ein genügend großer Lebensraum vorhanden ist und wahrscheinlich weiterhin vorhanden sein wird, um langfristig ein Überleben der Populationen dieser Art zu sichern; (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie bzw. FFH-Richtlinie), gelistet. Für die unterschiedliche Behandlung wurden (bisher) sowohl geographische Regionen und Grenzen als auch politische (Staats)Grenzen als Grundlage herangezogen:
strenge Schutzsystemregelung des Art. 12 der FFH-Richtlinie (sowie diesbezügliche Abweichungserfordernisse gemäß Art. 12 iVm Art. 16 FFH-Richtlinie) gelten bei notwendigen Maßnahmen im Zusammenhang mit Arten des Anhang V nicht (mehr) zwingend. Dieser Beurteilungsspielraum der Mitgliedstaaten für notwendige Maßnahmen ist durch die Pflicht begrenzt, dafür zu sorgen, das die Entnahme der Exemplare aus der Natur und die Nutzung dieser Exemplare mit der Erhaltung dieser Art in einem günstigen Erhaltungszustand3, im (jeweiligen) natürlichen Verbreitungsgebiet, vereinbar sind. Zwar kann es in diesem Zusammenhang (in einem zweiten Schritt) mitunter zur grenzüberschreitenden Betrachtung (Niveau des Rechtsschutzes in den anderen Mitgliedstaaten oder Drittländer, Grad der Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden) kommen, jedoch muss der günstige Erhaltungszustand in erster Linie (weiterhin) zwangsläufig auf
Foto: Getty Images
örtlicher und nationaler Ebene beurteilt werden. Dies bedeutet, dass bei Subpopulationen, bei denen ein grenzüberschreitender Austausch –welcher im übrigen sogar die genetische Variabilität dieser Subpopulation stärken kann – stattfindet, primär (zunächst) die Situation auf örtlicher und nationaler Ebene zu bewerten sein wird.4
(EUROPAWEITES) WOLFSMONITORING
Nachdem die Erfassung und Beurteilung des günstigen Erhaltungszustands auch in Zukunft ein Kernelement für die Zulässigkeit von jagdrechtlichen Verwaltungsmaßnahmen bilden wird, ist ein umfassendes, örtliches, regionales, nationales und auch grenzüberschreitendes Monitoring der zentrale Baustein für künftige gezielte Managamententnahmen, dies unter wissenschaftlicher Begleitung und (wie bisher) strenger behördlicher Kontrolle. Die Chance auf ein europaweites einheitliches und abgestimmtes bzw. zumindest weiter angleichendes Wolfsmonitoring hat sich durch
ES IST DAVON AUSZUGEHEN, DASS IN (OBER)ÖSTERREICH ALLE BETEILLIGTEN STAKEHOLDER WEITERHIN GUT ZUSAMMENARBEITEN WERDEN.
die Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen und des gleichen bzw. einheitlichen Schutzstatus erhöht. Meiner Einschätzung nach wird das Wolfsmanagement insgesamt von dieser rechtlichen Gleichbehandlung mittel- und langfristig profitieren. Je mehr valide Zahlen, Daten und Fakten künftig durch das Wolfsmonitoring erhoben werden, desto wirksamer können Maßnahmen auf örtlicher und nationaler Ebene und
auch im grenzüberschreitenden Zu sammenhang durchgeführt wer den. Es ist davon auszugehen, dass in (Ober)Österreich alle beteilligten Stakeholder weiterhin gut zusam menarbeiten werden. Genetische Untersuchungen, Erhebungen (Be senderungen), Mitteilungen (Erfas sung auf Wildtierkameras), Sichtun gen, Losungs- und Rissmeldungen (für DNA-Auswertungen) usw., wel che gemeinsam aktiv von Jägerin nen und Jägern, Landwirtinnen und Landwirten sowie Bürgerinnen und Bürgern an Wolfsbeauftragte und Rissbegutachter, an weitere Fachex perten (Forschungsinstitut für Wild tierkunde und Ökologie, Österreich zentrum Bär Wolf Luchs) und an die Behörden herangetragen und in weiterer Folge ausgewertet werden, sind dabei wichtige Elemente für ein flächendeckendes und nachhaltiges Wolfsmonitoring.
MONITORINGSTANDARDS
In Europa anerkannt als Methodik für das Monitoring von Wölfen im Bereich des Artenschutzes ist eine Anlehnung an die sogenannten SCALP-Kritieren („Status and Con servation of the Alpine Lynx Popu lation“ ) beim Luchsmonitoring im Alpenraum.
C1-Kategorie eindeutiger Nachweis („hard facts“)
Harte Fakten, die die Anwesenheit der entsprechenden Tierart eindeutig bestätigen (Lebendfang, Totfund, genetischer Nachweis, Foto, Telemetrieortung).
C2-Kategorie (bestätigter Hinweis, „soft facts – confirmed“)
Von erfahrener Person überprüfter Hinweis (z.B. Spur oder Riss), bei dem ein Wolf als Verursacher bestätigt werden konnte. Die erfahrene Person kann den Hinweis selber im Feld oder anhand einer aussage-
4 Vor kurzem befasste sich der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) in seinem Urteil vom 12. Juni 2025, C-629/23 betreffend die Republik Estland mit der Zulässigkeit derartiger artenschutzrechtlicher bzw. jagdrechtlicher Maßnahmen auf der Grundlage von Art. 14 der FFH-Richtlinie.

Qualität im 3er Set: das Komplettpaket für perfekte Wildburger. Wildburger














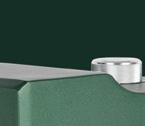




















Setpreis 282,95 EUR 240,50 EUR -15 % Jetzt
Europa und der Wolf: Zwischen Schutz und Herausforderung
kräftigen Dokumentation von einer dritten Person überprüfen und bestätigen.
C3-Kategorie (unbestätigter Hinweis, „soft facts – unconfirmed“)
Alle Hinweise, bei denen ein Wolf als Verursacher auf Grund der mangelnden Indizienlage von einer erfahrenen Person weder bestätigt noch ausgeschlossen werden konnte. Dazu zählen z.B. Sichtbeobachtungen ohne Fotobeleg, auch von erfahrenen Personen; ferner alle Hinweise, die zu alt, unzureichend oder unvollständig dokumentiert sind, zu wenige Informationen für ein klares Bild enthalten (z.B. bei Spuren) oder aus anderen Gründen für eine Bestätigung nicht ausreichen. Die Kategorie C3
Subpopulationen Anzahl Länder
kann in Unterkategorien, wie „wahrscheinlich“ und „unwahrscheinlich“ unterteilt werden.
Vorrangig relevant für die Beurteilung des Wolfsvorkommens bzw. der Wolfspräsenz in Oberösterreich bzw. in Österreich sind Nach- und Hinweise der Kategorien C 1 und C 2. Ziel des Wolfsmonitorings ist es, durch die Überwachung der Wolfspopulation (Größe, Entwicklung, Verbreitungsgebiet, Reproduktion etc.) einen günstigen Erhaltungszustand zu erreichen bzw. beizubehalten. Neben den Erkenntnissen zum Erhaltungszustand der Wolfspopulation selbst, liefert das Monitoring ebenso wichtige Informationen für die Öffentlichkeitsarbeit sowie für
POPULATIONSTREND
Alpine Subpopulation Rd. 2000 Österreich, Italien, Frankreich, Schweiz, Slowenien, Deutschland zunehmend
Zentraleuropäische Subpopulation Rd. 3000
Dinarisch-balkanische Subpopulation Rd. 4700
Österreich, Deutschland, Polen, Niederlande, Dänemark, Belgien, Luxemburg, Tschechien zunehmend
Österreich, Slowenien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro, Nordmazedonien, Albanien, Serbien, Griechenland, Bulgarien zunehmend
Karpatische Subpopulation mehr als 4000 Österreich, Slowakei, Tschechien, Polen, Rumänien Ungarn, Serbien stabil bzw. zunehmend

Herdenschutzmaßnahmen, bietet Grundlage für Entschädigungen und ist die Basis für wissenschaftliche Schlussfolgerungen und damit langfristig für behördliche Entscheidun-
ES PROFITIEREN
MEHRERE EBENEN VON ENTSPRECHENDEN MONITORINGMASSNAHMEN.
gen. Es profitieren daher mehrere Ebenen von entsprechenden Monitoringmaßnahmen. Die Frage, wie mit den Ergebnissen dieses Monitorings, also den konkreten Referenzwerten in Bezug auf Verteilung, Vorkommen und Dichte betreffend den günstigen Erhaltungszustand im jeweiligen Land bzw. in der jeweiligen Region umzugehen ist, wird sich im Verlauf der kommenden Jahre zeigen. Die bisherigen Monitoringergebnisse für (Ober)Österreich zeigen, dass bei uns vorrangig Wölfe aus der jeweils im Trend zunehmenden alpinen und mittel- bzw. zentraleuropäischen Flachlandpopulation leben bzw. (Ober)Österreich regelmäßig passieren und durchstreifen. Vereinzelt können Nachweise von Wölfen aus der dinarisch-balkanischen und aus der karpatischen Subpopulation zugeordnet werden.
FAZIT
Der Wolf als geschützte und jagdbare Tierart kann nunmehr künftig Gegenstand von (erweiterten) Verwaltungsmaßnahmen unterschiedlicher Ausgestaltung sein. Diese Maßnahmen müssen den Anforderungen an Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen Besonderheiten Rechnung tragen. Für eine Koexistenz zwischen Wolf und Mensch in der Kulturlandschaft Europas und damit auch der von Oberösterreich wird es künftig, bei allfälligen weiteren Verwaltungsmaßnahmen, welche im Übrigen nicht mit Managementmaßnahmen
bei Risiko- und / oder Schadwölfen oder Wolfshybriden gleichzusetzen sind, weiterhin darum gehen, die öffentliche Sicherheit und das Sicherheitsgefühl im ländlichen Raum zu garantieren. Weiters, erhebliche Schäden in der Land- und Almwirtschaft (an Nutztieren) sowie der Forstwirtschaft zu verhindern, zum Schutz der Jagdwirtschaft (mitunter betreffend andere jagdbare Wildtierarten) beizutragen, die Aspekte der touristischen Nutzungsansprüche zu berücksichtigen, praxistauglichen und realitätsnahen Herdenschutz zu etablieren, Interessen des Natur- und Artenschutzes zu achten und gleichzeitig den günstigen Erhaltungszustand dieser geschützten Tierart zu beobachten, zu sichern und zu bewerten. Jägerinnen und Jäger können für diese (gesamtgesellschaftliche) Herausforderung zunehmender Wolfspräsenz einen wichtigen Beitrag im Rahmen ihrer
jagdrechtlichen Aufgaben, Befugnisse und Kenntnisse erbringen. Meiner Einschätzung nach befindet sich ganz Europa nunmehr auf einem einheitlicheren Pfad im Bereich des (langfristigen) Wolfsmanagments. Eine interessenausgleichende Kombination von steter Öffentlichkeits- und Informationsarbeit, Herdenschutz, unbürokratischen Entschädigungen, gezielten Entnahmen von Risiko- und Schadwölfen, Managementzonierungen und (möglicherweise präventiven und proaktiven sowie regional differenzierten) Bestandsregulierungen wird dennoch ein herausfordernder Weg sein. Notwendige Transparenz und damit eine breite Beteiligung aller Interessensgruppen werden zugleich für mehr Akzeptanz sorgen.
Abschließend kann festgehalten werden, dass die rechtlichen Bestimmungen des geltenden Oö. Jagdgesetzes
2024 (zB §§ 42 Abs. 1, 43 Abs. 8, 56 Abs. 5 und 60 Abs. 4), die festgelegte ganzjährige Schonzeitregelung des § 16 Oö. Jagdverordnung 2024 (Anlage 11) für den Wolf und die erst vor kurzer Zeit erlassene Oö. Wolfsmanagementverordnung 2025 (als verlängerte Ausnahmeregelung), unter Berücksichtigung des momentanen (nachgewiesenen) Wolfsvorkommens im Bundesland Oberösterreich, derzeit einen rechtssicheren Rahmen für praxisnahe (jagdliche) Maßnahmen in unserem Bundesland festlegen. Zuletzt soll auch das im Jahr 2025 in Oberösterreich gestartete Pilotprojekt zum (verdichteten) Wolfsmonitoring nicht unerwähnt bleiben.


BEZAHLTE ANZEIGE


JAGD- UND WAFFENRECHT
FÜTTERUNG VON WASSERWILD

Grundsätzlich sind alle 16 jagdbaren Wildenten als heimische Wasservögel an die Lebensbedingungen in Oberösterreich sehr gut angepasst. Im Regelfall benötigen sie zum Überleben keine zusätzlichen Futtermittel. Elf dieser Wildenten sind ganzjährig geschont. Dazu zählen die Knäkente (Spatula querquedula), die Schnatterente (Mareca strepera), die Pfeifente (Mareca penelope), die Spießente (Anas acuta), die Löffelente (Spatula clypeata), die Kolbenente (Netta rufina), die Bergente (Aythya marila), die Moorente (Aythya nyroca), die Eisente (Clangula hyemalis), die Samtente (Melanitta fusca) und die Eiderente (Somateria mollissima). Bei diesen Entenvögeln sind an sich keine Entnahmen bzw. Abschüsse (ausgenommen Hegeentnahmen verletzter, kümmernder oder erkrankter Wildenten gemäß § 46 Abs. 4 Oö. Jagdgesetz 2024) zulässig. Sie unterliegen daher ausschließlich der jagdlichen Hegebefugnis- und -verpflichtung (§ 2 Abs. 3 Ziffer Oö. Jagdgesetz
2024 in Verbindung mit § 4 Abs. 2 Oö. Jagdgesetz 2024). Fünf Wildentenarten unterliegen hingegen einer einheitlichen Schonzeit (vgl. § 16 Oö. Jagdverordnung 2024 iVm Anlage 11) von 1. Jänner bis 15. September. Jagdzeit für Stockenten (Anas platyrhynchos), Krickenten (Anas crecca), Reiherenten (Aythya fuligula), Tafelenten (Aythya ferina) und Schellenten (Bucephala clangula) ist somit der Zeitraum von 16. September bis 31. Dezember. Bei diesen Federwildarten handelt es sich um Wasservögel. Ihr Lebensraum sind daher primär stehende und fließende Gewässer, wobei sie vorwiegend an großen Seen und Teichen, aber auch in kleinen Wald- und Wiesenbächen bzw. -gräben vorkommen. Die in Oberösterreich heimischen Wildenten kommen überwiegend in einer Seehöhe von unter 600 m, gelegentlich auch an höher gelegenen Bergseen, vor. Als Kulturfolger sind viele Entenarten in Bezug auf ihre bevorzugte Nahrung anspruch-
los und damit sehr anpassungsfähig. Als omnivore Art fressen sie alles, was sie verdauen und ohne großen Aufwand erlangen können. Zumeist handelt es sich um pflanzliche Stoffe wie Samen, Früchte, Wasser-, Uferund Landpflanzen, aber auch Laich, kleine Krebse, Frösche und Insekten stehen auf ihrem Speiseplan. Als (zusätzliche) Nahrung nehmen sie auch Mais, Weizen oder Gerste an.
FÜTTERUNGSERLAUBNIS, FÜTTERUNGSVERPFLICHTUNG UND FÜTTERUNGSVERBOT
Die in § 47 Oö. Jagdgesetz 2024 normierten Regelungen zur Fütterung von Wildtieren können in drei Bereiche unterteilt werden und gelten bezogen auf alle in Oberösterreich wild lebenden Entenvögel nur für die 16 genannten jagdbaren Wildenten. Es handelt sich hierbei um Vorgaben zum Fütterungsverbot, zur Fütterungserlaubnis und zur Fütterungsverpflichtung. Werden Wild-

tiere wie Enten gezielt gefüttert, hat dies angemessen, artgerecht und für die erforderliche Dauer zu erfolgen. Die Fütterung darf nur von den zur Jagdausbübung berechtigten Personen (den Jagdausübungsberechtigten, Inhaberinnen und Inhaber von Ausgangsscheinen) vorgenommen werden (vgl. § 51 Abs. 2 Oö. Jagdgesetz 2024). Erfolgen Wildfütterungen durch jagdfremde Personen, handelt es sich um eine schwerwiegende Verwaltungsübertretung (vgl. § 89 Abs. 2 Ziffer 13 Oö. Jagdgesetz 2024) mit
ERFOLGEN WILDFÜTTERUNGEN DURCH JAGDFREMDE PERSONEN, DROHEN MÖGLICHE GELDSTRAFEN VON BIS ZU
20.000 EURO.
einer möglichen Geldstrafe von bis zu 20.000 Euro. Zusätzlich müssen Jäger in Ausnahmesituationen („Notzeiten“) Wildenten – wie anderes jagdbares Wild –artgerecht und angemessen füttern. Eine solche Periode wird im Verordnungsweg durch die zuständige Jagdbehörde (Bezirksverwaltungsbehörde) nach Anregung bzw. Anhörung des Bezirksjägermeisters festgelegt. Es handelt sich hierbei um Zeiträume andauernder (nicht nur kurzfristiger) außergewöhnlicher Witterungsverhältnisse (z.B. Hochwasser, zugefrorene Gewässeroberfläche, starke Schneedecke im Uferbereich usw.).
Werden jagdbare Enten durch Jäger zulässigerweise während des Jagdjahres (vorwiegend im Herbst und Winter) gefüttert bzw. angekirrt („Lockfütterung“), gelten vorwiegend die zuvor genannten Vorgaben
der Angemessenheit und Artgerechtigkeit. Bei einer allfälligen Fütterung im Frühjahr bzw. Frühsommer wäre jedoch darauf zu achten, dass vor allem die Entenkücken in den ersten Wochen ausschließlich proteinreiche Nahrung wie Insekten benötigen. Zudem dürfen die Enten (Brutgelege, Schof) durch solche jagdlichen Fütterungsmaßnahmen während geltenden Schonzeiten nicht absichtlich gestört werden.
Nachdem Wildenten an das Leben in Oberösterreich angepasst sind, werden zulässige Fütterungsmaßnahmen stets im (un)mittelbaren jagdlichen Zusammenhang zu Beobachtungszwecken oder beabsichtigten Entnahme- bzw. Abschussmaßnahmen stehen.
Bei Maßnahmen der Lockfütterung haben sich, vorrangig bei den herbstund winterlichen Entenjagden1, folgende (Kirrungs-)Grundsätze bewährt:
- Es sollen mehrere kleine Kirrstellen eingerichtet werden;
- Das Kirrmaterial sollte im seichten Gewässer (bevorzugtes Gründelhabitat) oder im unmittelbaren Uferbereich ausgebracht werden;
- Gut binden lassen sich Enten mit pflanzlichem Futtermittel wie Mais, Weizen, Gerste oder mit Eicheln.
Nur der Vollständigkeit halber wird darauf hingewiesen, dass Nahrungsmittel wie Brot (noch dazu mit Zusatzstoffen wie Hefe, Zucker oder Salz) keine geeigneten Futtermittel darstellen. Die Möglichkeit zur Erlassung einer Verordnung des § 47 Abs. 6 Oö. Jagdgesetz 2024 betreffend (weitere) nähere Bestimmungen zur Wildfütterung (bei Entenvögeln) wurde von der Oö. Landesregierung bisher nicht in Anspruch genommen. Es liegen auch keine spezifischen Richtlinien des Oö. Landesjagdverbandes zur Fütterung von jagdbaren Wildenten bzw. jagdbaren Wasservögeln vor. Werden Fütterungen
1 Die Anwendung von Lockfütterungsmethoden kann sich zB bei der ganzjährig zulässigen Entnahme der (an sich nicht jagdbaren) invasiven Schwarzkopfruderente (Oxyura jamaicensis) im Rahmen des § 59 Oö. Jagdgesetz 2024 als notwendig erweisen.
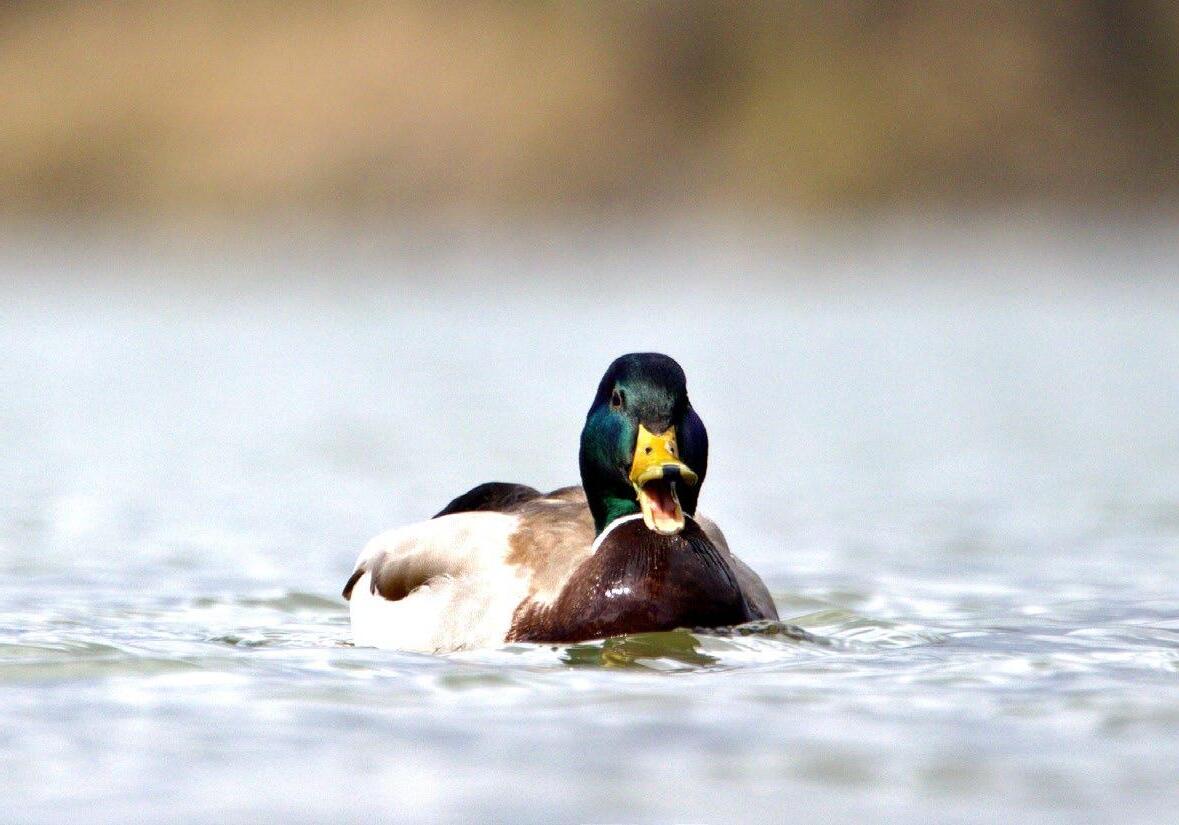
als (ständige) Jagdeinrichtungen z.B in der Form eines Futterautomats oder eines Futterspenders errichtet, ist darüber hinaus eine Zustimmung der Grundeigentümerin bzw. des Grundeigentümers (ausgenommen während einer behördlich angeordneten Notzeit) einzuholen (vgl. § 49 Oö. Jagdgesetz 2024).
WEITERE (MÖGLICHE)
EINSCHRÄNKUNGEN
Das (gelegentliche) Anlocken mit (sehr) geringen Futter- bzw. Kirrmittelmengen, die eventuelle Vornahme von Ablenkfütterungen oder dauernde Fütterungsmaßnahmen beim Federwild werden mitunter nicht in jedem Fall in und an Gewässern erlaubt sein.2 In Gewässern kann es z.B. bei zu großen Mengen an Futtermitteln sowie der dadurch bedingten erhöhten Konzentration dieser Wildvögel zu einer unnatürlich hohen Nährstoffanreicherung („direkte und indirekte Eutrophierung“) und damit zu einer Störung des ökologischen Gleichgewichts (Algenwachstum, Wassertrübung, Faulschlammbildung) in bestimmten Gewässerbereichen kommen. Der dabei anfallende
Phosphor aus Vogel- bzw. Entenkot kann zu einem unerwünschten (anthropogen verursachten) erhöhten (indirekten) Nährstoffeintrag führen. Es wird auch zu unterscheiden sein, ob Fütterungsmaßnahmen im Bereich eines schnell fließenden Gewässers (Selbstreinigungskraft), im flachen Uferbereich von Gewässern ohne relevante Strömungsvorgänge, in einem kleinen Teich (stehendes Gewässer) oder einem naturschutzrechtlich schützenswerten Klein-Biotop oder Quelllebensraum stattfinden und es sich um eine bloß kurzfristige Kirrung mit (sehr) geringen Futtermengen oder um dauernde Fütterungsmaßnahmen größeren Ausmaßes handelt. Bei (längeren) unnatürlich hohen Ansammlungen von Wasserbzw. Entenvögeln können im Wasser Bakterien der Gattungen Salmonella und Campylobacter fäkalcoliforme Bakterien wie Escherichia coli als (humanpathogene) Krankheitserreger auftreten. Bei hohem Eutrophierungsgrad und Temperatur kann das Auftreten der Zerkarien-Dermatitis (durch Saugwürmer der Gattung Trichobilharzi) begünstigt werden. Bei nicht bloß kurzzeitigen Maßnahmen
können gerade im Uferbereich unbeabsichtigt auch Wanderratten (Rattus norvegicus) angelockt werden (Krankheits- und Prädationsrisiko). Ebenfalls mit der Zulässigkeit zur Fütterung von Wildtieren zusammenhängende unmittelbar einschränkende naturschutzrechtliche Regelungen können nicht ausgeschlossen werden. Die rechtmäßige Ausübung der Jagd im Rahmen einer kurzfristigen bzw. vorübergehenden und in sehr geringem Ausmaß vorgenommenen Kirrung bzw. Lockfütterung wird überwiegend (wohl) nicht betroffen sein.
Betreffend des (wasserrechtlichen) Schutzes der Gewässer sind Fütterungsmaßnahmen im Einzelfall so zu gestalten, dass sich keine, die Erhaltung der natürlichen Beschaffenheit des Wassers (bzw. des Gewässerabschnittes) in physikalischer, chemischer und biologischer Hinsicht, beeinträchtigende Gewässerverunreinigung ergibt (nachteilige Einwirkungen auf die Beschaffenheit des Gewässers bzw. die Wassergüte). Sollten darüber hinaus z.B. ortspolizeiliche Verordnungen generell das Füttern von Wasservögeln an bestimmten Plätzen oder in stehenden / fließenden Gewässern verbieten, wird dies vor Ort im heimischen Jagdrevier zumeist bekannt sein.
ZUSAMMENFASSUNG
Nur örtlich berechtigte Jägerinnen und Jäger dürfen jagdbare Wildenten füttern. Für jagdfremde Personen besteht ein unmittelbares jagdgesetzliches Fütterungsverbot. Bei jenen Wildenten, für die eine Jagdzeit festgelegt ist, erfolgt diese zumeist im Rahmen der Lockfütterung („Kirrung“) an bestimmten Stellen, um sie zu erlegen bzw. jagdlich zu nutzen. Fütterungsmaßnahmen dürfen (jagdrechtlich gesehen) nur angemessen, artgerecht und (wohl) auf die erforderliche Dauer beschränkt erfolgen.

2 Im Landesjagdgesetz des deutschen Bundeslandes Schleswig-Holstein ist die Fütterung von (jagdbarem) Wild in und an Gewässern an sich nicht zulässig (§ 18 Abs. 1). In § 27 Abs. 2 Ziffer 5 der Landesjagdgesetzdurchführungsverordnung des deutschen Bundeslandes Nordrhein-Westfalen ist es (jagdrechtlich) an sich verboten Futter- oder Kirrmittel in Gewässer einzubringen oder in Uferbereichen auszubringen.
NEUES AUS DEM JAGDRESSORT
LRin Michaela Langer-Weninger PMM
WOLFSVERORDNUNG WEITERENTWICKELT –BIRKHUHNJAGD BLEIBT RECHTLICH MÖGLICH
Mit 1. Juli 2025 ist die neue Oö. Wolfsmanagementverordnung in Kraft getreten. Sie ermöglicht es, bei Risikowölfen schneller und rechtssicher zu handeln. Konkret kann nun eine Abschusserlaubnis bereits bei dokumentiertem Gefährdungsverhalten erteilt werden – eine vorherige zweifache Vergrämung ist nicht mehr notwendig. Der Entnahmeradius wurde

flexibler ausgestaltet und technische Hilfsmittel können unter bestimmten Bedingungen eingesetzt werden. Grundlage für diese Änderungen ist die neue EU-Rechtslage, die unter anderem eine Herabstufung des Schutzstatus sowie ein klärendes Urteil des EuGH umfasst.
Im Bereich des Federwildes gibt es auch Neues. Der Verwaltungsgerichtshof hat in seiner Erkenntnis vom 26. Mai 2025 festgestellt, dass die Entnahme von Birkhühnern generell zulässig ist. Eine präzisierte
Formulierung des Ausnahmegrundes bei der Entnahmebeantragung ist allerdings notwendig.
Das Land Oberösterreich hält an seinem klaren Kurs fest: Schutz und Erhalt von Auer- und Birkhuhn erfolgen durch ein Bündel an Maßnahmen – darunter verpflichtendes Monitoring, Lebensraumverbesserung und gezielte Entnahme unter streng kontrollierten Bedingungen. Die neue Federwildmanagementverordnung verankert diesen Ansatz klar im Rechtsrahmen – im Einklang mit nationalem und EU-Recht.
Ein besonderes Zeichen der Kontinuität setzt die Wiederwahl von Herbert Sieghartsleitner zum Landesjägermeister. Ich gratuliere ihm sehr herzlich zu seiner Wiederwahl und freue mich auf die weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit für eine sachorientierte, weidgerechte und zukunftsfeste Jagdpolitik in Oberösterreich.
Als Agrar-Landesrätin möchte ich der ARGE Wildbret auch auf diesem Wege nochmals herzlich zur Auszeichnung mit dem OÖ Agrarpreis 2025 in der Kategorie Öffentlichkeitsarbeit gratulieren.
Seit 14 Jahren setzt sie sich für Bewusstseinsbildung zur gesundheitlichen und geschmacklichen Bedeutung von Wildbret ein.
Die Jagd ist in Oberösterreich weit mehr als Hege und Entnahme. Sie ist gelebter Naturschutz, Biodiversitätsmanagement, Kulturlandschaftspflege und regionaler Wertschöpfungs-

faktor – vom Wald bis auf die Teller heimischer Wirtshäuser. Dieses Zusammenspiel aus Ökologie, Verantwortung und Handwerk macht die Jagd zu einem unverzichtbaren Teil unserer ländlichen Lebensweise.
Für die jagdliche Hochsaison im Herbst wünsche ich allen Jägerinnen und Jägern eine sichere und unfallfreie Jagd. Euch allen ein kräftiges Weidmannsheil!
Michaela Langer-Weninger, PMM Jagd-Landesrätin
LRin Michaela Langer-Weninger PMM
AUS DER. GESCHÄF TSSTELLE.

GEMEINSAM.SICHER MIT DER JÄGERSCHAFT

Am 17. Juli 2025 fand in den Räumlichkeiten der Landespolizeidirektion Oberösterreich im Rahmen der Initiative „Gemeinsam.Sicher mit der Jägerschaft“ die Auftaktbesprechung mit dem Oberösterreichischen Landesjagdverband statt.
Generalmajor Günther Humer begrüßte im Namen des Herrn Landespolizeidirektors den Landesjägermeister von Oberösterreich, Herbert Sieghartsleitner, sowie den Geschäftsführer des OÖ. Landesjagdverbands, Christopher Böck.
Gemeinsam mit Oberstleutnant Gerald Eichinger und Oberrat Michael Hubmann – beide übrigens passionierte Jäger – wurden aktuelle Entwicklungen sowohl im Bereich der Jägerschaft als auch im Bereich der Exekutive angesprochen. Diskutiert wurden neben dem neuen Oö. Jagdgesetz 2024 unterschiedliche Themen wie beispielsweise die Erreichbarkeit von Jägern bei Wildunfällen oder das Antragen von Fangschüssen von Polizistinnen und Polizisten, die gleichzeitig auch Jägerinnen bzw. Jäger sind.
KONTAKT
OÖ Landesjagdverband Hohenbrunn 1, 4490 St. Florian Telefon: 07224/20083-0
E-Mail LJV: office@ooeljv.at
E-Mail Oö Jäger: ooe.jaeger@ooeljv.at www.ooeljv.at / www.fragen-zur-jagd.at
ÖFFNUNGSZEITEN

Alle Beteiligten betonten im Rahmen eines sehr offenen Gesprächsklimas die schon bestehende, ausgezeichnete Zusammenarbeit und vereinbarten eine weitere Intensivierung der gegenseitigen Beziehungen, insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass der Oö. Landesjagdverband die Interessen von mehr als 21.000 Jägerinnen und Jäger im Bundesland vertritt.
Montag bis Donnerstag: 9:00 bis 12:00 Uhr und 12:45 bis 15:30 Uhr; Freitag: 9:00 bis 12:30 Uhr und nach Vereinbarung
Oberrat Michael Hubmann, Generalmajor Günther Humer, Landesjägermeister Herbert Sieghartsleitner, Geschäftsführer Christopher Böck und Oberstleutnant Gerald Eichinger (v.l.).
BENUTZERKONTEN GELÖSCHT
OÖ JAGDAPP – DIE TECHNIK UND IHRE TÜCKEN
Nach einem kürzlich erfolgten Update der OÖ JagdApp wurden im Zuge einer Datenbankbereinigung einige Benutzerkonten gelöscht. Betroffene Nutzer können sich jedoch problemlos neu registrieren, um wieder vollen Zugriff auf die App-Funktionen zu erhalten.
Die OÖ JagdApp bietet Jägerinnen und Jägern zahlreiche Vorteile für ihren Jagdalltag.
Anzeige der Jagdkarte (mit Foto (!), was eine Jagdkarte im Scheckkartenformat voraussetzt) ersetzt die Notwendigkeit, den Zahlungsbeleg mitzuführen. Beachten Sie, dass mit dem OÖ Jagdgesetz 2024 die digitale Jagdkarte als vollwertiger Lichtbildausweis fungiert.
• Versicherungsbestätigungen in fünf Sprachen: Versicherungsbestätigungen können in Deutsch, Englisch, Ungarisch, Rumänisch,

Neben den Schusszeiten, den jagdbaren sowie den invasiven Tierarten unter anderem folgende:
• Jederzeitige Gültigkeitsprüfung der Jagdkarte: Die App ermöglicht es, die Gültigkeit der Jagdkarte jederzeit digital festzustellen, wodurch das Mitführen eines ausgedruckten Zahlungsbeleges entfällt.
• Digitaler Nachweis: Die digitale
Tschechisch und Slowakisch als PDF-Dokument abgerufen und an die hinterlegte E-Mail-Adresse gesendet werden, um sie auszudrucken oder analog zu verwenden.
• Umfassende Informationen und Tools: Die App beinhaltet Funktionen wie einen Sonne- und Mondkalender, Infos zu Jagdhunden, Termine und Seminare, Formulare & Anträge, Notfallnummern, Infor-
mationen zum Versicherungsschutz sowie Informationen zu jagdfreien Tagen.
• Multigeräte-Nutzung: Der persönliche Login ermöglicht die Nutzung der OÖ JagdApp gleichzeitig auf mehreren Ausgabegeräten wie Smartphones und Tablets, unabhängig vom Betriebssystem.
Zusätzlich bietet die OÖ JagdApp nun eine neue Funktion: den Jagdplaner. Dieses Tool ermöglicht es Jagdleitern, Jagdgebiete anzulegen und Jägerinnen und Jäger einzuladen. Er dient als zentrale Verwaltung für Jagdgemeinschaften und bietet folgende Funktionen:
• Verwalten von Jägern
• Verwalten der JADA Zugangsdaten
• Anzeigen von Wildabgangsmeldungen
• Eintragen einer Wildabgangsmeldung
• Bearbeiten einer Wildabgangsmeldung
• Melden von Wildabgängen
GF Mag. Christopher Böck
ONLINE UNTER https://www.youtube.com/ watch?v=9AcqM_TqHRc
Auszug vom Juli 1934 aus dem Jagd-Buch der Jagarunde „Grüner Tisch“, welche sich regelmäßig im Aigner‘s Gasthaus zum schwarzen Rössl in der Ottensheimerstraße Nr. 4 in Linz/Urfahr trafen.

13 Die Verantwortung für jeden abgegebenen Schuss trägt der Schütze! Wild darf nur beschossen werden, wenn es für den Schützen zur Gänze sichtbar ist.
14 Nach Abblasen des Triebes ist das Gewehr zu entladen und geöffnet zu tragen!
15 Erlegtes Wild darf erst nach dem Abblasen des Triebes vom Schützen geholt werden.
16 (Vermutlich) Getroffenes und nicht gefundenes Wild ist dem Jagdleiter oder einem Hundeführer zu melden.
17 Leergeschossene Patronen sind mitzunehmen.
18 Signalfarbene Hutbänder sowie Signalkleidung für Hundeführer, Treiber und Schützen tragen wesentlich zur Sicherheit bei.
Hunde sind auf der Jagd mit Signalbändern auszustatten! Entlang der Verkehrswege gegebenenfalls Tafel „Achtung Jagdbetrieb“ aufstellen!


Sicherheit im Jagdbetrieb.
Regeln und Verhaltensmaßnahmen bei Bewegungsjagden wie Treibjagd, Riegel- oder Drückjagd Empfehlung des OÖ. Landesjagdverbandes · Stand September 2025
Waschbär 01. 01. – 31. 12.
Wiesel
Mauswiesel 8
Hermelin 01. 07. – 31. 03. Wildenten
Stock-, Krick-, Reiher-, Tafel- und Schellente 1 16. 09. – 31. 12. Wildgänse
Grau- und Saatgans 2 01. 08. – 31. 01. Wildkaninchen 01. 07. – 31. 01. Wildkatze 8
Schwarzwild
Keiler, Bache, Frischling 01. 01. – 31. 12.
Säugende Bache (mit gestreiften Frischlingen) 8
Wildtauben Hohltaube 8
Ringeltaube 01. 09. – 31. 01.
Türkentaube 21. 10. – 20. 02. Turteltaube 8
Wolf 8
Sonderverfügungen der Jagdbehörden sind zusätzlich zu berücksichtigen.
8 Ganzjährig geschont
1 Knäk-, Schnatter-, Pfeif-, Spieß-, Löffel-, Kolben-, Berg-, Moor-, Eis-, Samt- und Eiderente ganzjährig geschont.
2 Bläss-, Zwerg- und Kurzschnabelgans ganzjährig geschont.
3 Ausnahmebewilligungen im Frühjahr sind zu berücksichtigen.
www.ooeljv.at
JAGDBEGINN
Signale der Jagdhornbläser „Sammeln“ und „Begrüßung“
(Hut bleibt auf)
1 Der Jagdleiter begrüßt mit Weidmannsheil (alle lüften den Hut) und bringt die Sicherheitsregeln für die Jagd mit der Aufforderung zur strikten Einhaltung zur Kenntnis
2 Die Teilnahme an der Jagd ist nur mit gültiger Oö. Jagdkarte oder Jagdgastkarte möglich! Die Anweisungen des Jagdleiters sowie der Ansteller sind zu beachten.
3 Das Jagdgewehr ist außerhalb der Triebe entladen und geöffnet zu tragen. Achtung bei Flintenlaufgeschoßen: Führen Sie diese so mit, dass eine Verwechslung mit Schrotpatronen ausgeschlossen werden kann!
4 Es wird verlautbart, welches Wild schussbar ist.
5 Die Schützenstände werden vom Jagdleiter oder Ansteller zugeteilt. Den Anweisungen sind genau Folge zu leisten!
6 Es werden die Ansteller vorgestellt, die sich mit Hut lüften und/oder winkend kenntlich machen.

Alpenhase/Schneehase 16. 10. – 31. 12.
Auerhahn 3 8
Auerhenne 8
Birkhahn 3 8
Birkhenne 8
Blässhuhn 16. 09. – 31. 12. Braunbär 8
Dachs 01. 07. – 15. 01. Damwild
Hirsch 01. 09. – 31. 01. Tier & Kalb 16. 10. – 31. 01. Elch 8
Fasanhahn 16. 10. – 31. 12.
Fasanhenne 16. 11. – 31. 12. Feldhase 16. 10. – 31. 12.
Fischotter 8
Fuchs, adult 16. 05. – 28./29. 02.
Fuchs, juvenil 01. 01. – 31. 12. Gamswild
Jährlinge 01. 05. – 31. 12.
Sonstige 01. 08. – 31. 12. Graureiher 8
7 Das Verlassen oder Verändern des zugeteilten Standes ist verboten! Bei Sichtkontakt mit Handzeichen gegenüber dem Nachbarschützen auf sich aufmerksam machen.
8 Orientieren Sie sich genau, in welche Richtung kein Schuss abgegeben werden darf! (Schieß-Segment, Nachbarschütze, Nutztiere, Häuser, Straßen usw.)
9 Die Triebe werden an- und abgeblasen.
Oder: Uhrenvergleich, es ist jetzt ... Uhr. Der Trieb beginnt um ... Uhr und endet um ... Uhr.
10 Das Gewehr darf nach dem Anstellen / erst nach dem Anblasen des Triebes geladen werden.
Oder: Das Gewehr darf erst um ... Uhr geladen werden.
11 Das Linieren mit der Waffe durch die Schützenlinie ist streng verboten! Der Kugelfang ist zu beachten!
12 Das Schießen in den Trieb ist nur nach ausdrücklicher Anweisung des Jagdleiters/Anstellers erlaubt, ansonsten wegen Gefährdung von Treibern und Hunden verboten!
Goldschakal 01. 10. – 15. 03.
Habicht 8
Haselhahn 16. 09. – 30. 11.
Haselhenne 8
Höckerschwan 8
Luchs 8
Marder
Baummarder, Steinmarder 01. 07. – 31. 03.
Marderhund 01. 01. – 31. 12.
Mäusebussard 8
Mink 01. 01. – 31. 12.
Muffelwild
Widder 01. 06. – 31. 12.
Schaf & Lamm 01. 07. – 31. 12.
Murmeltier 16. 08. – 31. 10.
Rackelhahn 01. 05. – 31. 05.
Rackelhenne 8
Rebhuhn 16. 10. – 30. 11.
Rehwild Ier und IIer Bock 01. 06. – 30. 09.
Nach den geltenden Abschussrichtlinien für Rehwild und der Oö. Jagdverordnung 2024 IIIer Bock
& Kitz 16. 08. –
Rotwild
(I,
Führendes & nichtführendes
THEMA JUNGJÄGER: ERSTE HILFE IN DER JAGD
JEDE SEKUNDE ZÄHLT – FÜR DICH UND ANDERE!
Grundkenntnisse der Ersten Hilfe sind unerlässlich für eine sichere Jagd – sowohl beim Einzelansitz als auch bei Gesellschaftsjagden. Oft bewegen wir uns in Gebieten, in denen schnelle medizinische Hilfe kaum gewährleistet ist. Kleinere Verletzungen wie Schnittwunden beim Versorgen von Wild oder beim Bergen können jederzeit auftreten. Stürze oder Abstürze durch rutschige Leitern von Kanzeln kommen immer wieder vor. Auch Unfälle bei Revierarbeiten sind schnell passiert – hier ist rasche Hilfe oft unverzichtbar.
ERSTE HILFE ZU LEISTEN ERFORDERT MUT – UND MANCHMAL AUCH ÜBERWINDUNG. DOCH NICHTS ZU TUN, IST STETS DIE SCHLECHTESTE ENTSCHEIDUNG.
Doch nicht nur Unfälle fordern den Einsatz von Erster Hilfe. Auch Unterkühlung beim nächtlichen Winteransitz oder Dehydrierung an heißen Sommertagen können gefährlich werden. Hinzu kommt ein Risiko, das oft unterschätzt wird: mangelnde Selbsteinschätzung. Übermut oder Überanstrengung führen nicht selten zu Herz-Kreislauf-Problemen –und in schlimmsten Fällen auch zu Schussverletzungen. Hier zählt jede Sekunde! Vorausgesetzt natürlich,
man kann seinen Standort im Dickicht der Wälder noch bestimmen…
GRUNDLAGEN DER ERSTEN HILFE
Erste Hilfe zu leisten erfordert Mut – und manchmal auch Überwindung. Doch nichts zu tun, ist stets die schlechteste Entscheidung.
Alarmieren – Helfen. Dabei steht der Eigenschutz immer an erster Stelle: Waffe sichern, die Umgebung prüfen und mögliche Gefahrenquellen ausschließen, dass keine weiteren Risiken bestehen.
Beim Absetzen des Notrufs ist es essenziell, den Unfallort möglichst ge-

Einige grundlegende Maßnahmen, die zur Ersten Hilfe zählen, kann jeder von uns problemlos verinnerlichen.
Ein zentraler Punkt ist das Ingangsetzen der Rettungskette: Erkennen –
nau zu beschreiben. In unübersichtlichem Gelände oder abgelegenen Revieren kann das zur Herausforderung werden. Gute Ortskenntnis ist hier von unschätzbarem Wert, um die Rettungskräfte sicher an den richtigen Ort zu lotsen.
TEXT UND FOTOS: RUPERT J. PFERZINGER
Tipp: Die Bezirksstellen des Oö. Roten Kreuzes bieten beinahe monatlich Erste-Hilfe-Kurse im Rahmen von acht oder 16 Stunden an.
ERSTE-HILFE-AUSRÜSTUNG IM JAGDRUCKSACK
Für den Notfall sollte jeder Jäger über eine gut ausgestattete Erste-Hilfe-Ausrüstung verfügen. Der Jagdrucksack sollte daher die wichtigsten Utensilien enthalten, um im Ernstfall schnell und effektiv handeln zu können.
Dazu gehören:
Verbandpäckchen und sterile Kompressen, um Wunden schnell abzudecken und zu versorgen. Eine Schere zum Schneiden von Verbänden und Kleidung sowie Einmalhandschuhe zum Schutz vor Keimen und zur Vermeidung von Infektionen.
Ein Dreieckstuch um verletzte Gliedmaßen zu stabilisieren oder einen Druckverband anlegen zu können sowie eine Rettungsdecke, die im Falle einer Unterkühlung lebensrettend sein kann und gleichzeitig vor Wärmeverlust schützt.
Desinfektionsmittel, um Wunden zu reinigen, und Pflaster sowie Tape, um kleinere Verletzungen abzupuffern oder zu stabilisieren. Eine Zeckenzange darf ebenfalls nicht fehlen, um Zecken rasch und sicher zu entfernen.
Persönliche Medikamente wie Asthmaspray oder Allergiemittel sollten ebenfalls mitgeführt werden, um im Notfall schnell eingreifen zu können. Handy und Powerbank für den Notruf und die Kommunikation mit Rettungsdiensten – vergessen Sie nicht, dass auch im abgelegenen Gelände der Akku schnell leer werden kann. Eine Revierkarte sollte immer zu Hause hinterlegt werden, ebenso wie bei mitjagenden Personen. Sie sollte GPS-Koordinaten und Zufahrtswege zum Revier enthalten, um im Notfall schnell den Standort zu bestimmen und den Rettungsdiensten präzise Informationen zu geben. Funkgeräte sind in Gebieten ohne Mobilfunkempfang unerlässlich. Sie ermöglichen die Kommunikation zwischen
den Jägern und im Notfall auch die schnelle Koordination von Rettungskräften.
SITUATIONEN, NACH DENEN MAN SELBST „HILFE“ BENÖTIGT
Unfälle und das Leisten von Erster Hilfe hinterlassen nicht nur bei den Betroffenen Spuren, sondern auch bei denen, die helfen. Egal, ob bei Menschen oder Tieren – das Helfen in Notfällen kann emotional belastend sein. Zögern Sie nicht, sich Unterstützung zu holen und sich mit solchen Erlebnissen auseinanderzusetzen. Manches kann nicht einfach mit ein, zwei Bier bewältigt werden.

KONTAKT
Rupert J. Pferzinger Ansprechpartner für Jungjäger r.pferzinger@ooeljv.at 07224/20083-10
SHOP OÖ LJV
Direkt in der Geschäftsstelle oder online unter www.ooeljv.at/shop, finden Sie eine große Auswahl an Informationsmaterial und Artikeln zu den Themen Jagd und Jäger, Natur- und Naturschutz, Umweltbildung und heimische Tierwelt.
AUTOSCHILD
mit Saugnapf

SCHILD Achtung Wildbeobachtung
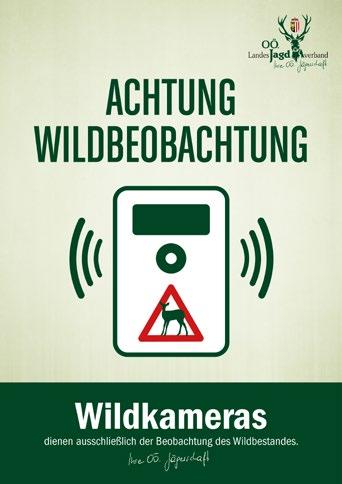
KAPPE MIT LOGO-STICK


KURSE & SEMINARE
JAGDLICHES BILDUNGS- UND INFORMATIONSZENTRUM (JBIZ)
Plattform der Wissens- und Informationsvermittlung
Kurse und Seminare mit Themen rund um die Jagd und das Jagdland Oberösterreich werden mit hervorragenden und anerkannten Referenten und Verbandsfunktionären in der Geschäftsstelle laufend vorbereitet und in sowie um Hohenbrunn und tlw. in den Bezirken angeboten.
Stornobedingungen: Die Kursgebühr ist nach Erhalt der Anmeldebestätigung zu entrichten, ansonsten kann der Seminarplatz an einen Wartelistenplatz vergeben werden. Bis eine Woche (sieben Tage) vor
FREITAG,
17. OKTOBER 2025
jeweils von 09:00 bis ca. 17:00 Uhr
JBIZ Schloss Hohenbrunn
Seminargebühr:
€ 95,– (inkl. Mittagsimbiss)
€ 75,– (inkl. Mittagsimbiss) für Jäger mit gültiger Oö. Jagdkarte:
Seminarleiter: Mag. Christopher Böck
Referent: Dr. med. vet. Josef Stöger
Begrenzte Teilnehmerzahl!
Seminarbeginn ist die Stornierung kostenfrei. Falls Sie nicht teilnehmen können, melden Sie sich daher bitte rechtzeitig vom Seminar ab! Die Nichteinzahlung der Seminargebühr bedeutet nicht gleichzeitig die Abmeldung vom Seminar.
Anmeldung: Bei allen Seminaren ist eine vorherige Anmeldung erforderlich! Die Anmeldung erfolgt ausschließlich online über unsere Kundenzone! Informationen zum Seminar und zur Zahlung erhalten Sie automatisiert nach erfolgreicher
Anmeldung. Folgen Sie dem Link, um sich gleich anzumelden: https://kundenzone.ooeljv.at/de/ seminare
Haben Sie Probleme oder wollen Sie uns etwas mitteilen? Rufen Sie einfach 07224/20083 oder schreiben Sie uns: office@ooeljv.at
WILDBESCHAUKURS
Ausbildungskurs zur „kundigen Person“ nach dem Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz gemäß § 27 Abs 3 LMSVG BGBL. Nr. 13/2006
Die Wildbrethygiene ist und bleibt ein wichtiger Bestandteil der Jagd, die ja das ursprünglichste Produkt liefert: Unser wertvolles und ernährungsphysiologisch hochwertiges Wildbret.
Die Beschau des erlegten Wildes durch den Erleger bzw. die Erlegerin und die „kundige Person“ stellen eine hohe Verantwortung, jedoch auch ein Privileg der Jägerschaft dar. Hierfür sind Sorgfalt und Fach- sowie spezifische Rechtskunde unabdingbar. In diesem ganztägigen Kurs mit anschließender Prüfung werden die Grundlagen sowie Grundkenntnisse und die gesetzlichen Vorschriften einer „kundigen Person“ vermittelt. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen ab 18 Jahren mit einer gültigen Jagdkarte.
ANMELDUNG
Teilnahme an allen Kursen und Seminaren nur mit vorheriger Online-Anmeldung über unsere Kundenzone:
FREITAG, 17. OKTOBER 2025
MONTAG,
20. OKTOBER 2025
16:00 bis 19:00 Uhr
SZI Schießzentrum Innviertel
Geiersberger Straße 12 4921 Hohenzell
Seminargebühr:
€ 90,– (exkl. Munition) für Jäger mit gültiger OÖ Jagdkarte
€ 120,– für Nichtjäger
Seminarleiter:
Mag. Christopher Böck
Referent:
Julian Partinger und Christian Winter Begrenzte Teilnehmerzahl!
MITTWOCH, 22. OKTOBER 2025
09:00 bis 12:30 Uhr
JBIZ Schloss Hohenbrunn
Seminargebühr: € 50,-–
Für Jäger mit gültiger Oö. Jagdkarte: € 35,–
Seminarleiter:
Mag. Christopher Böck
Referent: Dr. med.vet. Josef Stöger
Begrenzte Teilnehmerzahl!
SCHIESSTRAINING FÜR DRÜCKJAGDEN – SCHIESSKINO
Eine erfolgversprechende Riegeljagd bedarf einer perfekten Vorbereitung. Mit diesem Schießtraining im Schießkino erhalten Sie das optimale Rüstzeug um bei der Drückjagd in einer typischen Schneise bei unterschiedlichen Distanzen, Geschwindigkeiten, Richtungen und Hindernissen sicher treffen zu können und dabei auch den Überblick zu bewahren.
In diesem modernsten Schießkino kommen nach dem letzten Stand der Technik unterschiedliche Filmvorlagen für verschiedene Anforderungen und Schwierigkeiten zum Einsatz. Es kann mit der eigenen Waffe (keine Kaliberbegrenzung) geschossen wer-
den, oder es stehen für dieses Seminar auch alle gängigen Repetierwaffen mit hochwertiger Riegeloptik als Leihwaffe zur Verfügung.
Das Schießtraining wird von einem professionellen Schießtrainer begleitet, der Ihnen praktische Tipps und wertvolle Hinweise gibt. Dieses Seminar gilt als Schießnachweis.
Ihre Vorteile:
• Leihwaffen mit Optik
• Schießtrainer mit Tipps
• Schießnachweis
AUFFRISCHUNGSKURS
FÜR BEREITS KUNDIGE PERSONEN DER WILDBRETUNTERSUCHUNG
Um immer auf dem aktuellen Stand zu sein, bietet der Oö Landesjagdverband einen Auffrischungskurs für bereits „kundige Personen der Wildbretuntersuchung“ an. Der Schwerpunkt des Kurses wird auf aktuelle Seuchen und Krankheiten sowie
brisante Fälle in diesem Zusammenhang gelegt. Aber auch Änderungen und Neuerungen zur Gesetzeslage werden erläutert und besprochen.
MARKIERUNGSECKE
Ein sehr aktueller und interessanter Fall kommt diesmal aus dem Bezirk Steyr:
MARKE 11038 BLAU
Diese Markierung wurde im Mai 2024 in der GJ St. Ulrich bei Steyr vorgenommen.
Am 20.Juli 2025 tauchte der Jährling erstmalig im Revier Steinbach am Ziehberg I auf und wurde aufgrund der schwachen körperlichen Verfassung und der geringen Trophäe erlegt. Die linke Geweihstange war abgebrochen und hohl, Beim Aufbrechen zeigten sich massive Verkapselungen in der Leber (Zysten Leberegel).
Die Entfernung vom Markierungsort beträgt knapp 40 Kilometer Lufilinie. Es ist leider nicht bekannt, wann die Abwanderung über eine durchaus bemerkenswerte Strecke erfolgte. Weidmannsdank an R. Willersberger für die Informationen.
Gleichsam als Pendant dazu aus dem Bezirk Urfahr:
MARKE 12131 WEISS
Dieser vierjährige Sechserbock aus dem Revier Haibach/Mkr wurde am 3. Juni 2025 - nur etwa 200 Meter (!) vom Markierungsort entfernt – Opfer eines Verkehrsunfalles.
Eine außerordentliche Geschichte zu einem der ältesten Böcke der Markierungsaktion wird aus dem Bezirk Vöcklabruck berichtet:
MARKE 13145 BLAU
Nach einem tödlichen Verkehrsunfall einer Geiß wurden die beiden verwaisten Kitze von Familie Mayrhofer in Niederthalheim 2013 erfolgreich mit Ziegenmilch aufgezogen. Ein Bockkitz, genannt ,,Franzi“ wurde mit 13145 blau und das Geißkitz
„Sissi“ mit 13144 blau am rechten Lauscher markiert. Zur besseren Wiedererkennung wurde den beiden zusätzlich am linken Lauscher eine rote Marke verpasst. Das Bockkitz wurde sicherheitshalber vom Tierarzt kastriert. Es war aber von vornherein keine Gehegehaltung beabsichtigt und daher wurden die menschlichen Kontakte auf das Notwendigste beschränkt. Im Herbst erfolgte eine Übersiedlung vom Garten in ein für den Winter geeignetes Gehege nach Oberau. Bereits im Jänner 2014 wurden die beiden doppelt markierten Kitze in die Freiheit entlassen.
Das Schmalreh hat sich im Frühjahr einem guten Bock angeschlossen und ist letztendlich abgewandert. An der Gemeindegrenze zu Aichkirchen konnte es aber noch mehrmals beobachtet werden. Danach verliert sich die Fährte, das weitere Schicksal von „Sissi“ blieb leider unbekannt. Trotz der auffälliger Doppelmarkierung gab es auch keine Rückmeldung. Vielleicht erinnert sich der Erleger und holt nach Lesen dieser Zeilen die Meldung nach!?
„Franzi“ zeigte sich sehr standorttreu, führte aber ein eher vorsichtiges, zurückgezogenes Leben und war nur selten auf Freiflächen anzutreffen. Regelmäßig besuchte er die heimatlichen Winterfütterungen und war bis Februar 2025 stets auf der Revierkamera abgelichtet. Bedauerlicherweise wurde er am 9. Mai 2025 im Ortsgebiet von Iming auf der B135 überfahren. Gewicht aufgebrochen 18 kg. Das Kiefer zeigt für das hohe Alter von immerhin zwölf Jahren einen durchaus guten Zustand und relativ geringen Abnützungsgrad.
Es handelt sich daher nachweislich um einen der ältesten Böcke im Zuge der gesamten Markierungsaktion des OÖ Landesjagdverbandes!

Dank an Johann Mayrhofer für die Details!
Helmut Waldhäusl Landeskoordinator
Der StreamingKanal des OÖ LJV: ooeljv.at/tv
JAGDKURSE des
OÖ Landesjagdverbandes
Die Jagdkurse können in einem beliebigen Bezirk besucht werden. Die Jagdprüfung muss jedoch in jenem Bezirk abgelegt werden, in welchem sich der ordentliche Hauptwohnsitz befindet. Wenn Sie in Oberösterreich über keinen Hauptwohnsitz verfügen, können Sie die Jagdprüfung bei einer beliebigen Prüfungskommission in Oberösterreich ablegen.
BRAUNAU
JAGD- UND JAGDHÜTERKURS
Jagd- und Wurftaubenklub
„St. Hubertus“ e.V. Braunau am Inn Mit Zerwirkkurs und Sachkundenachweis zum OÖ Hundehaltegesetz
Beginn: Donnerstag, 30. Oktober 2025, 19:00 Uhr
Ort: Wirt z‘Aching, Aching 1, 5280 Braunau am Inn
Kursabende: Montag und Donnerstag
Anmeldung:
Georg Ranftl
Tel: +43 676 4545145
E-Mail: mail@jaga.cc
JAGD- UND JAGDHÜTERKURS
Mit Zerwirkkurs am Praxistag im eigenen Jagdrevier.
Beginn: Donnerstag, 30. Oktober 2025, 19:00 Uhr
Ort: Polytechnische Schule, Trattmannsbergerweg 4b, 5230 Mattighofen
Kursabende: Montag und Donnerstag (Präsenz und Online)
Anmeldung:
OSR Franz Stöger
Tel: +43 664 2326116
E-Mail: franz.stoeger61@gmail.com
Die Anmeldung zu den Vorbereitungskursen richten Sie bitte gleich an den jeweiligen Jagdkursleiter.
Dies kann per E-Mail, telefonisch oder auch mit dem Anmeldeformular auf unserer Website www.ooeljv. at sein. Bei Fragen stehen Ihnen die jeweiligen Kursleiter gerne zur Verfügung.
Bitte beachten Sie, dass bei der Anmeldung für den Ausbildungskurs noch keine Anmeldung zur Jagdprüfung notwendig ist. Dies wird im Lauf des Kurses mit dem Kursleiter gemeinsam veranlasst.
EFERDING
JAGDKURS
Infoabend: 25. November 2025 um 18:30 Uhr im Kurslokal
Kursbeginn: 08. Jänner 2026
Ort: Seminarraum Raiffeisenbank
Eferding, Schiferplatz 24, 4070 Eferding
Kursabende: Dienstag und Donnerstag, 18:30–21:30 Uhr
Die Teilnahme am Kurs ist aufgrund beschränkter Teilnehmerzahl nur nach Voranmeldung möglich!
Anmeldung und Auskunft: Gerhard Hahn
Tel: +43 660 3563799
E-Mail: jagdkurs.eferding@outlook.com
FREISTADT
JAGD- UND JAGDHÜTERKURS Mit Sachkundenachweis zum OÖ Hundehaltegesetz
Beginn: 08. Jänner 2026
Ort: Gasthaus Postl, Selker 1 4230 Pregarten
Anmeldung und Auskunft:
Wolfgang Atteneder
Tel: +43 680 2051505
E-Mail: wolfgang.atteneder@polizei.gv.at
GMUNDEN
JAGD- UND JAGDHÜTERKURS
Beginn: Jänner 2026
Ort: St. Wolfgang im Salzkammergut Anmeldung, Information und Fragen: Akdm. Jagwirt Ing. OJ Josef Rieger Jagdakademie Salzkammergut
E-Mail: jagdakademierieger@gmail.com
JAGDKURS
Beginn: Oktober 2025
Ort: Forstliche Ausbildungsstätte Traunkirchen, Waldcampus Österreich, Am Forstpark 1 4801 Traunkirchen
Anmeldung und Auskunft:
Ofö. Ing. Othmar Schmidinger Tel: +43 664 1987006
E-Mail: othmar.schmidinger@gmail.com
JAGDHÜTERKURS
Beginn: Jänner 2026
Ort: Forstliche Ausbildungsstätte Traunkirchen, Waldcampus Österreich
Anmeldung:
Ofö. Ing. Othmar Schmidinger Tel: +43 664 1987006
E-Mail: othmar.schmidinger@gmail.com
JAGDKURS
Infoabend: 08.Jänner 2026 um 19.00 Uhr in der Johann Nestroy Mittelschule
Beginn: Mitte Jänner 2026 nach Absprache
Ort: Johann Nestroy Mittelschule Kaiser-Franz-Josef Straße 6, 4820 Bad Ischl
Anmeldung:
Ofö. Ing. Michael Schwarzlmüller Tel: +43 664 460 459 4
E-Mail: jungjaegerkurs@gmx.at
GRIESKIRCHEN
JAGD- UND JAGDHÜTERKURS
Beginn: 05. Jänner 2026
Ort: Gasthaus Schörgendorfer, Dorfplatz 1, 4712 Michaelnbach
Kurstage: Montag und Dienstag Hinweis: Begrenzte Teilnehmerzahl – vorherige Anmeldung erforderlich!
Anmeldung: ab Oktober
Elisabeth Haberfellner
Tel: +43 664 88592652
E-Mail: jagdkurs.gr@ooeljv.at
KIRCHDORF
JAGD- UND JAGDHÜTERKURS
Beginn: Donnerstag, 08. Jänner 2026, 19:00 Uhr
Ort: Gasthaus „Wirt in Strienzing“, 4552 Wartberg an der Krems
Kurstage: Montag und Donnerstag, jeweils ab 19:00 Uhr
Kursform: Präsenz & teilweise online
Anmeldung:
Helmut Sieböck
Tel: +43 676 4441222
E-Mail: h.sieboeck@gmail.com oder
Dr. Stefan Waser
E-Mail: stefan.waser@gmx.at
JAGD- UND JAGDHÜTERKURS
Infoabend: 05. Dezember 2025, 18:00 Uhr
Kursbeginn: 07. Jänner 2026
Kurstage: Mittwoch und Freitag ab 18:00 Uhr
Ort: Inzersdorfer Dorfstub‘n, Dorfplatz 1, 4565 Inzersdorf im Kremstal Anmeldung und Auskunft: Jakob Demberger Tel: +43 660 1295014
E-Mail: jakob.demberger@gmx.at Web: www.jagdkurs-ooe.at
LINZ/LINZ-LAND
JAGD- UND JAGDHÜTERKURS
Beginn: Kurs I (MO & MI)
07. Jänner 2026
Beginn: Kurs II (DI & DO)
08. Jänner 2026
Ort: Schützenverein LHA – Linz, Gasthaus „Löwenfeld“, Wienerstraße 441, 4030 Linz
Dauer: Bis ca. Mitte Mai
Auskunft und Anmeldung: ab Anfang November
Engelbert Zeilinger
Tel: +43 664 4012628
E-Mail: zeilinger@hagel.at
PERG
JAGD- UND JAGDHÜTERKURS
Infoabend: 26. November 2025, 19:00 Uhr im Kurslokal
Ort: Gasthof „Wirt in Auhof“, Auhof 11, 4320 Perg
Kursabende: Mittwoch und Freitag, 19:00 – 22:00 Uhr
Praktische Ausbildungen werden tlw. auch an anderen Wochentagen durchgeführt. Der Kurs dauert bis zur Jagdprüfung im Mai 2026
Anmeldung und Auskunft: Mag. (FH) Peter Gründling Tel: +43 650 2234410
E-Mail: jagdkurs-perg@outlook.com
JAGD- UND JAGDHÜTERKURS
Beginn: 02. Jänner 2026
Ort: Waffengeschäft, Hauptstraße 47, 4222 Langenstein
Anmeldung und Auskunft: Christian Hanl
Tel: +43 664 3701369
E-Mail: fasan11cc@gmail.com
RIED
JAGD- UND JAGDHÜTERKURS
Beginn: 14. Jänner 2026
Ort: Kirchenwirt in Tumeltsham Kursabende: Mittwoch und Donnerstag, 19:00 – 22:00 Uhr
Teilnahme: Nur nach Anmeldung per E-Mail und positiver Rückmeldung
Anmeldung: DI Hanspeter Haferlbauer
E-Mail: haferlbauer@gmail.com oder
Rudolf Auinger
E-Mail: rauinger@gmail.com
ROHRBACH
JAGD- UND JAGDHÜTERKURS
Mit Sachkundenachweis für Hundehaltung
Ort: Meierhof Schloss Sprinzenstein
Kursabende: Mittwoch 19:00 – 22:00 Uhr und Samstag 08:00 – 11:00 Uhr Hinweis: Kurs 2026 ist ausgebucht. Vormerkung für Jänner 2027 möglich.
Kursleiter und Anmeldung: Ing. Sebastian Köppl Tel: +43 664 8298976
E-Mail: ing.sebastian.koeppl@gmail.com
SCHÄRDING
JAGDKURS
Beginn: 08. Dezember 2025
Ort: Landwirtschaftliche Fachschule
Otterbach
Kursabende: Montag und Freitag, 19:00 – 22:00 Uhr
Anmeldung:
Albert Langbauer
Tel: +43 680 1121944
E-Mail: albert.langbauer@gmx.at
STEYR/STEYR-LAND
JAGD- UND JAGDHÜTERKURS STEYR UMGEBUNG
Beginn: Montag, 03. November 2025, 19:00 Uhr.
Ort: Landgasthof Mayr, Pfarrplatz 3, 4400 St. Ulrich/Steyr
Anmeldung: Rudolf Pressl
Tel: +43 664 3259300
E-Mail: rudi.pressl@aon.at
JAGD- UND JAGDHÜTERKURS WEYER
Beginn: Freitag, 07. November 2025
Ort: Wird kurzfristig bekannt gegeben
Kursform: Präsenz und teilweise online
Anmeldung:
Karl Garstenauer
Tel: +43 680 1101460
E-Mail: karl.garstenauer@gmail.com oder
Fa. Jagd und Fischerei Pichler
Tel: +43 7355 7363
E-Mail: office@jagd-fischerei.at
URFAHR-UMGEBUNG
JAGDKURS
Infoabend und Beginn: Mittwoch 10. Dezember 2025, 19:00 Uhr
Ort: Gasthof Seyrlberg, Fam. Rohrmannstorfer, Seyrlberg 5, 4204 Reichenau
Kursabende: Montag und Mittwoch von 19:00– 22:00 Uhr, bis Mai 2026
Anmeldung:
Christoph Göweil
Tel: +43 664 927 30 52
E-Mail: Jagdverein.nord@gmail.com
VÖCKLABRUCK
JAGDKURS
Beginn und Dauer: November 2025 bis Ende Mai 2026 mit der Jagdprüfung
Ort: Landwirtschaftsschule Vöcklabruck
Kurstage: Dienstag und Donnerstag, 19:00 – 22:00 Uhr
Anmeldung: https://www.ooeljv.at/ wp-content/uploads/2024/12/ VB_Anmeldeformular-JAGDKURS. doc
JAGDHÜTERKURS
Der Kurs für das Jagdschutzorgan wird mit Jänner 2026 neu gestartet. Anmeldung ab Anfang April 2025 möglich.
Anmeldung: https://www.ooeljv.at/ wp-content/uploads/2024/12/ VB_Anmeldeformular-JSO.doc
Kontakt und Information:
BJM Anton Helmberger
Tel: +43 664 73751318
E-Mail: vb@ooeljv.at
WELS/WELS-LAND
JAGDKURS
Der Klassiker unter den Kursen! Beginn: 07. Jänner 2026
JAGDKURS SOMMER
Kompakt und intensiv! Beginn: 10. Juli 2026
JAGDHÜTERKURS
Beginn: 01. April 2026
Informationsabende und Anmeldung für ALLE Kurse:
23. Oktober und 27. November 2025 jeweils 19:00 – 21:00 Uhr im GH Zirbenschlössl, 4621 Sipbachzell Kontakt, Anmeldung und weitere Informationen zu den Kursen: Florian Lehner BSc.
Tel: +43 680 1166166
E-Mail: office@ehrenschild.at Web: www.ehrenschild.at
JAGDKURS GUNSKIRCHEN
Infoabend: 03. November 2025, 19:00 Uhr
Beginn: 05. Jänner 2026, 19:00 Uhr, gleicher Ort
Ort: GH Schmöller, 4623 Gunskirchen
Anmeldung: Robert Madaras
Tel: +43 664 3558992
E-Mail: jagdkurs.wels@gmx.at
Erstellt von Helmut Sieböck
PRÜFEN SIE IHR WISSEN NACHT IN SICHT
1. WELCHE GEFAHREN UND WELCHEN GEFÄHRDUNGSBEREICH BIRGT EIN SCHROTSCHUSS?
a Höhengefährdung
b Weitengefährdung
c Breitengefährdung
d Winkelgefährdung
e Abprallgefährdung (Geller)
2. UNTER WELCHER BEDINGUNG ERREICHT EIN BÜCHSENGESCHOSS SEINE MAXIMALE FLUGWEITE?
a mit Rückenwind
b mit Aufwind
c mit einem Lauferhöhungswinkel von etwa 10 Grad
d mit einem Lauferhöhungswinkel von 30 – 35 Grad
e mit einem Lauferhöhungswinkel von 50 – 55 Grad
3. WAS VERSTEHT MAN UNTER DEM FREIFLUG DES GESCHOSSES?
a den Weg des Geschosses nach dem Verlassen des Laufes
b wenn das Geschoss von keinen Hindernissen gestoppt wird
c den Weg des Geschosses nach dem Durchschlagen des Wildkörpers
d den Weg des Geschosses nach dem Verlassen des Hülsenhalses bis zum Eintreten in die Felder des Gewehrlaufes
e den Weg des Geschosses im Lauf
4. WELCHE IST DIE BESTE UND SICHERSTE SICHERUNG?
a die Abzugsicherung
b die Abzugstangensicherung
c die Schlagstücksicherung
d die Schlagfedersicherung
e die Schlagbolzensicherung
f das entladene Gewehr
5. WIE VERHÄLT MAN SICH BEI EINEM NACHBRENNER (VERSAGER)?
a sofort den Verschluss öffnen und die Patrone aus dem Lager nehmen
b die Waffe ohne zu öffnen dem Büchsenmacher bringen
c sofort den Verschluss öffnen und 20 – 30 Sekunden warten
d die Laufmündung gegen einen geeigneten Kugelfang richten und den Verschluss erst nach 20 - 30 Sekunden öffnen
Die Lösungen finden Sie auf Seite 66.

UNSER BESTES WÄRMEBILDGERÄT
100% VERLÄSSLICHER TREFFPUNKT
FLEXIBLER EINSATZ
FOTO/VIDEO FUNKTION

IM VISIER. DIE JAGD. IN DER ÖFFENTLICHKEIT.


DER WEG ZUM AMA GENUSSREGION GÜTESIEGEL
Im Gespräch mit BJM Christian Pfistermüller und Jagdleiter Klaus Grünberger
Die Jagdgesellschaft Neuhofen/ Krems ist Partner des Genusslandes OÖ. Die Voraussetzung für diese Partnerschaft ist das führen des AMA Genussregion Gütesiegels. Dieses staatlich anerkannte Gütesiegel garantiert geprüfte, regionale Herkunft und Qualität der Wildprodukte. Eine unabhängige Kontrollstelle prüft die geforderten Kriterien.
Seit Februar 2024 führt die Jagdgesellschaft Neuhofen/Krems das AMA GENUSS REGION Gütesiegel. Weshalb hat sich die Jagdgesellschaft Neuhofen relativ rasch um dieses Gütesiegel bemüht?
BJM Christian Pfistermüller, Jagdleiter der JG Neuhofen an der Krems: Die Jagdgesellschaft Neuhofen ist seit 2011 Mitglied der ARGE

WILDBRET. Diese Mitgliedschaft bedingt eine gemeldete Betriebsstätte der Wild-Direktvermarktung. Somit waren unsere Mitglieder der Jagdgesellschaft überzeugt, dass wir die Voraussetzungen für das AMA Genussregion Gütesiegel erfüllen und die Vorteile in Anspruch nehmen können. Die Kontrolle durch eine unabhängige Prüfstelle war dann tatsächlich Formsache.
Welche Vorteile ergeben sich durch das Gütesiegel?
BJM Pfistermüller: Das Gütesiegel ist die Voraussetzung für die Partnerschaft mit dem Genussland OÖ. Diese Partnerschaft bringt das Lebensmittel Wildbret ganz nahe an den Konsumenten und somit wird ein ganzheitliches Verständnis für eine nachhaltige Jagdausübung beim Konsumenten gefördert.
Durch das Genussland OÖ ist eine professionelle Öffentlichkeitsarbeit garantiert, davon profitieren wir in Neuhofen/Krems und die gesamt Jagd in OÖ.
Auch die Jagdgesellschaft Grünbach bei Freistadt bewirbt sich um die Erlangung des AMA GENUSS REGION Gütesiegels.
Jagdleiter Klaus Grünberger, JG Grünbach bei Freistadt:
Als Jagdleiter ist es mir wichtig, dass die gesamte Jägerschaft in Grünbach bei Freistadt bei den Entscheidungs-

prozessen eingebunden wird, deshalb ist die Vorbereitung für solche Meilensteine eher langfristig angelegt. Im kommenden September findet ein letztes Informationsgespräch durch das Genussland OÖ statt. Ich bin überzeugt, dass wir danach das Erlangen des AMA Genussregion Gütesiegels mit großer Mehrheit anstreben werden. Das Lebensmittel Wildbret hat so viele Vorzüge, die wir durch diese Partnerschaft noch deutlicher vor den Vorhang bringen werden.
Das Gespräch führte Sepp Nöbauer

BJM Christian Pfistermüller
Klaus Grünberger, Jagdleiter von Grünbach bei Freistadt
wild auf Wild
Des Jägers bestes Produkt
VELOUTÉ VOM FASAN
MIT WURZELGEMÜSE UND BRÖSELKNÖDEL
Rezept für vier Personen
ZUTATEN
FOND / SUPPE
• 500 g Fasanenkarkassen
• 2,5 L Wasser
• 150 g Wurzelgemüse, geschält und grob gewürfelt
• 500 g Fasanenkeulenoder Brustfleisch
• 50 g Speck in Würfel geschnitten
• 1 Zwiebel
• 100 g Butter
• 250 ml Rotwein
• 2 l Fasanenfond
• 250 ml Schlagobers
• 125 g Creme Fraîche
• 250 g Wurzelgemüse, geschält und in feinste Würfel geschnitten als Einlage
• 125 ml Sherry Fino zum Abschmecken
• Maisstärke
Lorbeerblätter, frisch gezupfte
Thymianblätter und Wacholder nach Geschmack
Etwas gemahlene Nelken, Salz, Pfeffer, Muskatnuss und Zitronenzeste zum Abschmecken
BRÖSELKNÖDERL
• 100 g Butter
• 1 Ei
• 1 Dotter
• Salz
• Muskatnuss
• 200 g Semmelbrösel
• 40 ml Milch


FÜR DEN FOND
Das Fasanenfleisch von Sehnen und Häuten befreien, in 1x1 cm große Würfel schneiden und anbraten. Das Fleisch rausgeben und im selben Topf 150 g grob gewürfeltes Wurzelgemüse, die Sehnen und Häute sowie die Fasanenkarkassen geben und mit 2,5 l kaltem Wasser aufsetzen. Für mindestens 1 Stunde, besser sogar 2 Stunden, leicht köcheln lassen. Nur leicht salzen.
Optional für mehr Geschmack: Die Fasanenkarkassen zuvor für eine Stunde bei 160 °C im Backofen rösten.
FÜR DIE SUPPE
Die Zwiebel würfeln, in der Butter mit den Speckwürfeln anbraten und mit Rotwein aufgießen, reduzieren und mit 2 Liter passiertem Fond auffüllen. Gewürze, Salz und Pfeffer zugeben, nach etwa 10 Minuten den Suppenansatz samt Gewürzen sehr fein mit einem Mixstab pürieren. Das angebratene Fasanenfleisch sowie das fein würfelig geschnittene Gemüse zugeben und anschließend ca. 30 – 45 Minuten sanft weich köcheln.
Zum Schluss das Obers und die Creme fraîche zugeben, kräftig abschmecken und mit dem Sherry verfeinern. Mit in etwas kaltem Wasser angerührter Maisstärke zur gewünschten Konsistenz abbinden. Alternativ können Sie auch „Fix Einbrenn“ zum Binden der Suppe verwenden.
TIPP: Die Velouté kann auch mit gerösteten Edelkastanien, gebratenen Shiitake-Pilzen oder Eierschwammerl als Einlage verfeinert werden.
BRÖSELKNÖDERL
Butter, Ei und Dotter schaumig schlagen. Die Brösel mit der Milch vermengen und salzen. Alles gut vermengen und die Masse eine Stunde ruhen lassen. Kleine Knödel formen und in schwach wallendem Wasser ziehen lassen, bis sie gar sind.
Gutes Gelingen wünscht euch Rupert J. Pferzinger, „Schlosskoch“ des OÖ Landesjagdverbandes

Wilde Alltagsküche
Leicht gemacht!
ĆEVAPČIĆI VOM WILD
MIT OFENKÜRBIS UND PAPRIKA-ZITRONEN-GURKENSALAT
Rezept für vier Personen
ZUTATEN
ĆEVAPČIĆI VOM WILD
• 500 g Wildfaschiertes (Reh, Rotwild oder Wildschwein)
• 10 g Salz
• Pfeffer nach Geschmack
• Paprikapulver nach Geschmack
• 2 Knoblauchzehen
• 1 rote Zwiebel
• 100 g Wasser
OFENKÜRBIS
• 1 kleiner Hokkaido-Kürbis
• 1 Zweig Rosmarin oder Thymian
• 4 EL Olivenöl
• Pfeffer nach Geschmack
• Kreuzkümmel nach Geschmack
• 80 g Feta
• Einige Nüsse (z.B. Walnüsse oder Haselnüsse), gehackt oder ganz
• 4 TL Honig
PAPRIKA-ZITRONEN-GURKENSALAT
• 1 Gurke, in Scheiben geschnitten
• 2 Paprika, in Streifen geschnitten
• 2 Zitronen, geschält und in Scheiben geschnitten
• Ca. 4 EL weißer Balsamicoessig
• 2 EL neutrales Pflanzenöl
• Salz nach Geschmack
• Eine Prise Zucker
• Etwas gehackter Knoblauch

ĆEVAPČIĆI VOM WILD
Zwiebel und Knoblauch fein schneiden. In 100 g Wasser etwa 1 Minute aufkochen und anschließend vollständig abkühlen lassen. Das Faschierte in eine Küchenmaschine geben, kräftig mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver würzen. Das abgekühlte Zwiebelwasser hinzufügen. Die Masse 2–3 Minuten kneten lassen, bis sie glatt und geschmeidig ist. Mit feuchten Händen oder einem Spritzsack die Masse zu kleinen Ćevapčići formen und in eine leicht geölte Form legen. Die Ćevapčići auf dem Grill oder in der Pfanne goldbraun garen.
Tipp: Für den besten Geschmack und die richtige Konsistenz sollten die Ćevapčići mindestens 2 Stunden, idealerweise aber über Nacht im Kühlschrank ruhen.
OFENKÜRBIS
Den Kürbis gründlich waschen (nicht schälen!), vierteln und die Kerne entfernen. Anschließend in mundgerechte Spalten schneiden. Die Kürbisspalten mit Olivenöl, den Gewürzen
REZEPT

und dem Honig gut vermischen. Den marinierten Kürbis in eine Auflaufform oder auf ein mit Backpapier belegtes Blech geben. Den Feta würfeln oder zerbröseln und zusammen mit den Nüssen über den Kürbis streuen. Im vorgeheizten Backofen bei 160 °C Ober-/Unterhitze für 30–35 Minuten backen, bis der Kürbis weich und leicht gebräunt ist.
PAPRIKA-ZITRONEN-GURKENSALAT
Alle vorbereiteten Zutaten in einer Schüssel zu einem knackigen, frischen Salat vermengen. Kurz vor dem Servieren ziehen lassen, damit sich die Aromen verbinden können.
Tipp für den passenden Dip: Für eine köstliche Ergänzung vermengen Sie einen Löffel Mayonnaise mit ein bis zwei Löffeln Dijon- oder Estragonsenf, einem Löffel Honig sowie einer Prise Currypulver und Salz.
Gutes Gelingen wünscht
Rupert J. Pferzinger, „Schlosskoch“ des OÖ Landesjagdverbandes


REKORDJAGD BEI DER 30. WEIDMANNSHEIL TROPHY im Golfclub Metzenhof
Am 28. Juni war es so weit: Die Weidmannsheil Trophy feierte unter der Regie von Heribert Sendlhofer und Uwe Kroiß ihr 30. Turnier im Golf-
die Blicke gen Himmel. Weinverkostungen durch den Jungwinzer Schiefermair und angeregte Gespräche ließen den Nachmittag verfliegen.

club Metzenhof – und das mit einem sportlichen Paukenschlag.
Bei strahlendem Sonnenschein und ausgelassener Stimmung wurde der bestehende Platzrekord regelrecht gesprengt: Ein Team erzielte im Rahmen des Vierer-Texas-Scramble-Turniers sensationelle neun unter Par –ein neuer Maßstab in der Geschichte der Trophy.
Das Turnier wurde auch heuer wieder zu einem ganz besonderen Treffpunkt der heimischen Jagd- und Golfgemeinschaft, musikalisch eröffnet von der Jagdhornbläsergruppe Hohenbrunn.
Nach dem sportlichen Teil erwartete die Teilnehmer ein vielseitiges Rahmenprogramm:
Der Linzer Flugakrobat Johann Fesl begeisterte mit einer spektakulären Show und zog mit tollen Manövern
Mit feinem Rehcarpaccio und zartem Hirschrücken an EierschwammerlRotweinsauce mit Serviettenknödeln wurde kulinarisch groß aufgefahren.
Der Höhepunkt des Abends war die feierliche Siegerehrung und Tombola, bei der zahlreiche Preise der großzügigen Sponsoren Kettner, OÖ Landesjagdverband, Golfhouse und vielen weiteren Partnern zur Verfügung gestellt wurden.
Der Erlös aus der Versteigerung eines Gemäldes von Dr. Markus Povacz kam einem wohltätigen Zweck für Jugendwohngemeinschaften zugute und geht an die Lions Clubs Pasching, Neuhofen sowie Leonessa Wels. Schon jetzt blicken viele voller Vorfreude auf die nächste Austragung. Die 31. Weidmannsheil Trophy findet am 27. Juni 2026 erneut im Golfclub Metzenhof statt.

Rössler Signature®
Allround Kal. Standard mit Optik
EAW Fokus HD 50
Triple Use Wärmebildkamera mit LaserEntfernungsmesser und Zielgerät plus EAW Montage
Aktionspreis
5999,–
LRP 7115,–
In einem Gerät: Beobachtung Vorsatzgerät Zielgerät

FÜR ALLE RÖSSLER
PRODUKTE GILT:
• Innovatives Handspannsystem
• Mündungsgewinde mit Schutzhülse
• Moderne Wechsellauftechnologie
• Überlegene Sicherheit durch Drehwarzenverriegelung
GENERALVERTRIEB WAFFEN IDL
Weitere Infos zu Rössler-Händlern in Ihrer Nähe: +43 4852 636660, office@waffen-idl.at
WEIL JAGD MEHR IST... DIE JÄGERSCHAFT
AUF DER LANDESGARTENSCHAU 2025
Im Rahmen der Landesgartenschau in Schärding präsentiert sich die oberösterreichische Jägerschaft unter dem Motto „Weil Jagd mehr ist...!“ mit einem vielfältigen und informativen Programm.
Unterstützt vom OÖ Landesjagdverband und der Landesgartenschau GmbH lädt die Präsentation der Jagdgesellschaft Schärding sowie der Bezirksgruppe Schärding Besucherinnen und Besucher aller Altersgruppen ein, die faszinierende Welt der Jagd, der heimischen Wildtiere und des Naturschutzes hautnah zu erleben.
In einem eigens gestalteten Bereich erwartet die Gäste eine spannende Entdeckungsreise durch die heimische Tierwelt. Zahlreiche interaktive Stationen informieren über Wildtiere, deren Lebensräume und die wichtige Rolle der Jagd im ökologischen Gleichgewicht. Ob Groß oder Klein – für jede Altersgruppe gibt es etwas zu entdecken: von kindgerechten Erlebnisstationen über Präparate und Anschauungsmaterial bis hin zu Fachgesprächen mit Jägerinnen und Jägern.
Ein besonderes Highlight war der „Tag der Jagd“ am 25. Juni, bei dem Landesjägermeister Herbert Sieghartsleitner sowie LJV-Geschäftsführer Mag. Christopher Böck gemeinsam mit der Jägerschaft des Bezirkes Schärding, allen voran BJM Alois Selker und Del. Stefan Schneebauer, die Landesgartenschau offiziell besichtigten. Nach einem gemeinsamen Rundgang durch das Gelände sorgten die Pramtaler Jagdhornbläser mit einem stimmungsvollen Konzert für den musikalischen Ausklang des Tages.

Es gab großes Lob für die wunderschön gestaltete Gartenschau und die eindrucksvolle Präsentation der Jagd im Sinne von Bildung, Bewusstsein und gelebtem Naturschutz.
Die Jägerschaft zeigt mit ihrer Präsenz auf der Landesgartenschau, dass Jagd weit mehr ist als das Jagen selbst – sie ist engagierter Naturschutz, aktiver Artenschutz und ein unverzichtbarer Teil des nachhaltigen Miteinanders von Mensch und Natur.
INFORMATION
OÖ. Landesjagdverband www.ooeljv.at Landesgartenschau Schärding 2025 www.innsgruen.at
ooe_landesjagdverband
ARGE WILDBRET MIT DEM OÖ. AGRARPREIS AUSGEZEICHNET

Die ARGE WILDBRET setzt sich für Bewusstseinsbildung zur gesundheitlichen und geschmackvollen Bedeutung des Lebensmittels Wildbret ein. Seit 2011 arbeitet die ARGE in enger
Abstimmung mit Bildungseinrichtungen, Interessensgruppen, Gastronomien, Fleischerbetrieben und regionalen Nahversorgern zusammen und holt Oberösterreichs Wildbret
WILD-KOCHKURS ZU HASE & FASAN
Heimisches Wild – fein
Wie bringt man einen Feldhasen elegant auf den Teller? Wie lässt sich ein Fasan zeitgemäß und doch traditionsbewusst zubereiten? Dieser Kochkurs zeigt, wie heimisches Wildbret nicht nur nachhaltig, sondern auch geschmacklich ein echtes Highlight sein kann – modern interpretiert, ohne seinen Charakter zu verlieren.
Termin: Donnerstag, 13. November 2025
Zeit: 16:00 bis ca. 22:00 Uhr
Ort: Theresiengut am Pöstlingberg, Hohe Straße 246, 4040 Linz
Kosten: € 140,– (inkl. 4-gängigem Menü, jeder Menge „Know-How“ samt Rezepten und Getränkebegleitung
Teilnehmerzahl: max. 10 Personen
Referent: Rupert J. Pferzinger
vor den Vorhang. Agrar-Landesrätin Michaela Langer-Weninger betonte bei der Preisverleihung, „die Zukunft wird dort gestaltet, wo Menschen bereit sind, Verantwortung zu übernehmen – für Umwelt, Gesellschaft und nachfolgende Generationen. Der Agrarpreis ist daher nicht nur Anerkennung für außergewöhnliches Engagement, sondern auch ein Impulsgeber für die gesamte Branche“.
„Die Auszeichnung mit dem OÖ Agrarpreis 2025 in der Sonderkategorie Öffentlichkeitsarbeit – Wert der Landwirtschaft, regionaler Zusammenhalt, ist eine besondere motivierende Würdigung unserer Arbeit, dafür sind wir sehr dankbar“, so Mag. Sepp Nöbauer, Sprecher der ARGE WILDBRET.
und vielseitig
zubereitet

Spitzenkoch, leidenschaftlicher Jäger und Gründer der privaten Kochschule www.pferzinger.at sowie Mitglied der ARGE Wildbret. Seine Kurse stehen für ehrliches Handwerk, moderne Wildküche und praktische Tipps für zuhause.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen nicht nur fundiertes Wissen rund um die Zubereitung von Hase und Fasan, sondern erleben in gemütlicher Atmosphäre, wie sich Wildfleisch kreativ, zeitgemäß und alltagstauglich einsetzen lässt.
Wichtig: Bitte Kochschürze und eigenes Küchenmesser mitbringen!
ANMELDUNG
Mag. Sepp Nöbauer
Tel.: 0664/5804576
E-Mail: j-noebauer@linznet.at
LEBENSRAUM.

Wertvolle
PFLANZEN im Jagdrevier
VON DI ANDREAS TEUFER
BFZ – Bäuerliche Forstpflanzenzüchter 4264 Grünbach, Helbetschlag 30 www.bfz-gruenbach.at
ROTER HARTRIEGEL
(Cornus sanguinea)
Der Rote Hartriegel gehört zur Familie der Hartriegelgewächse (=Cornaceae). Sein Name stammt von den dunkelroten Blättern im Herbst und teilweise auch vom roten Holz seiner Äste. Der deutsche Name stammt vom althochdeutschen Wort „hartrugil“, was so viel wie hartes Holz bedeutet.
VERBREITUNG UND BESCHREIBUNG
Der Rote Hartriegel ist ein sommergrüner, bis zu 3m hoher Strauch mit rutenförmig aufsteigenden Ästen. Die Rinde ist durch Längs- und
Querrisse in kleine charakteristische Felder geteilt. Typisch für den Roten Hartriegel ist der unangenehme Geruch des Holzes. Er wird nur selten über 30 Jahre alt und wird von der Kornelkirsche (= Cornus mas) durch die nackten Knospen ohne Knospenschuppen unterschieden. Die Blätter sind gegenständig, breit elliptisch bis eiförmig, zugespitzt, besitzen einen glatten Rand und zeigen deutlich ausgeprägte Blattnerven. Die Blüten erscheinen erst nach dem Laubaustrieb im Mai/Juni, sind weiß und wohlriechend. 20 – 50 Blüten sind in bis 5 – 7cm großen Schirmrispen aus-
gebildet. Die erbsengroßen Früchte erscheinen im Zeitraum September/ Oktober, anfänglich grün, später blauschwarze beerenartige Steinfrüchte. Wiederum charakteristisch sind die rot gefärbten Fruchtstiele. Die Früchte sind für den Menschen ungenießbar, aber ungiftig. Die Verbreitung erfolgt meistens durch Vögel. Der Rote Hartriegel hat eine breite ökologische Anpassungsfähigkeit. Sein Vorkommen reicht von der kollinen Höhenstufe bis ca. 900m. Bevorzugt werden frische, basenund mineralstoffreiche Lehmböden. Er verträgt viel Schatten, doch findet

man ihn häufig auch an Waldrändern. Das natürliche Verbreitungsgebiet erstreckt sich von Europa über die Türkei und den Kaukasus bis nach Mittelasien.
NUTZUNG
In der heutigen Zeit hat das Holz kaum mehr eine Verwendung. Als Brennmaterial gibt es eine sehr starke Hitze. Früher wurden die jungen, elastischen Zweige als Ladestöcke bei Gewehren, Pfeifenröhren und Eimerbändern verwendet. Das Fruchtfleisch der Früchte liefert einen Farbstoff, die Samen können zu einem Speiseöl verarbeitet werden, das auch in der Seifenindustrie verwendet wird. Dem Roten Hartriegel wurden vor allem aber auch wundersame Eigenschaften gegen die Tollwut nachgesagt, wahrschein-
lich deshalb, weil der Absud (Früchte wurden abgekocht) dazu verwendet wurde, räudige Hunde zu waschen und zu heilen. Die Blüten dienen als Bienenweide und die Früchte als Nahrung für verschiedenste Vogelarten. Die Früchte sind nicht giftig, roh jedoch ungenießbar. Das Fruchtfleisch ist reich an Vitamin C und so wird es auch heute teilweise noch gern zu Marmeladen verarbeitet. In der Forstwirtschaft wird der Rote Hartriegel gezielt bei stark erodierten Böden eingesetzt (speziell in südlicheren Ländern). Wegen des ausgreifenden Wurzelvermögens ein idealer Bodenfestiger, wo nach und nach versucht wird, Bäume auf diesen Flächen wieder einzubringen.

SINGVÖGEL im Revier
Von Sabine Humpl BA
HÄHNCHEN
Regulus regulus WINTERGOLD-

TROPHY
EINLAGERUNGSAKTION
18. Aug. bis 29. Nov. 2025


Angebote & Beratung
Ing. Leonhard Kupfer T 0664/88 66 29 57
trophy-wildfutter.at
Exklusiv im Lagerhaus.

Top-Angebot
Das Wintergoldhähnchen ist die kleinste Vogelart Europas, die Körpergröße beträgt nur etwa neun Zentimeter bei einem Gewicht von bis zu sieben Gramm. Es ist überwiegend graugrün gefärbt, auffällig ist allerdings der gelbe, schwarz eingerahmte Scheitelstreif, der allerdings bei Jungvögeln fehlt. Beim Männchen sind einige innere Scheitelfedern orangefarben.
Der Gesang und die Rufe der Wintergoldhähnchen sind so hoch, dass sie von vielen Menschen gar nicht oder nur in unmittelbarer Nähe wahrgenommen werden können und gleichen einem „si-si-si“ oder „sit-sit-sit“.
VORKOMMEN
Das Wintergoldhähnchen ist grundsätzlich ein Nadelwaldbewohner mit einer starken Bindung an Fichten und andere kurznadelige Baumarten. Im Gebirge trifft man es in Beständen von Zirben bis rund 2000m Höhe.
Quelle:

„Landscape of Fear“ ist heute in der Wildbiologie eine Phrase, die den Stress und die Angst der Beutetiere beschreibt, die sie durch den Räuber erleiden.
Das hat nicht nur Auswirkungen auf das Individuum, sondern auch auf die ganze Population und dann auf das Ökosystem. Evolutionär gehören wir für die meisten Tiere eher zu den Räubern als zur Beute. Wir prägen die Landschaft entscheidend so, wie sie das Wild erlebt. Nicht nur mit Traktor und Motorsäge, sondern auch mit unserer Anwesenheit. Während mein Hund frei von Angst ist,
für ihn ist jeder Wald, jede hohe Wiese und jedes Feld ein großer Abenteuerplatz. Jeder Bach muss überquert werden, auf der anderen Seite könnte ja was Besonderes sein. Er kämpft aber auch nicht jederzeit ums Überleben wie das Wild.
Jenes von uns beim Pirschen beunruhigte Reh wird nicht nur beim Äsen gestört und holt die Nahrungsaufnahme halt später nach. Durch die von uns erzwungene Flucht steigt der Energiebedarf, erhöht sich die Unsicherheit vor der nächsten Störung, verändert es die Zeit des Ausziehens, werden auch die Nachbarrehe be-
unruhigt. Verbissen werden dann mitunter die Tannen im Waldrand, nicht die Blumen auf der Wiese. Der Bock löst seine aufgestaute Energie schlechtesten Falls am federnden Ahornheister. Heister sind junge, schlanke Laubholzbäume. Kitze lernen von der Geiß vorsichtig zu sein, wenn ein Auto langsam vorbeifährt, so wie die Krähen. Letztlich reduziert Stress das Durchschnittsgewicht der Population, erkennbar auch bei den Trophäen. Das alles geschieht auch, wenn wir am Ansitz nur schauen, und nicht jagen. „Wennst schauen willst, geh ins Kino“, sagte ein alter Försterkollege. „Im Revier
Foto: KI, Shutterstock
sei gerichtet, zum Schießen, oiwei“. Erstaunlich ist, dass sich Rehe oder Gams an harmlose Spaziergänger gewohnt haben. Sie unterscheiden also zwischen sich laut unterhaltenden, rot-blau gewandeten Steckerlgehern und heimlich schleichenden, olivfarbigen Gewandträgern mit tannengrünem Lodenfleck. Untersuchungen belegen, dass die Beunruhigung durch die Jagd höher ist als durch Wanderer – also unsere Verantwortung.
Beim Wild kann man Stresshormone praktischerweise in der Losung nachweisen – ohne Blutdruckmesser und Säuregehalt im Magen, womit ich ihn bei mir am besten feststelle. Ohne ihn am lebenden Tier messen zu müssen. Bewegen wir Menschen uns im Wald auch in einem Angst-Raum? Ist die ach so entspannende Natur nur idealisiert, Romantisierung als Zivilisationsluxus? Halten wir uns nicht viel lieber im eigenen – auch grünen – Garten auf, wo wir jede Blume kennen und schnell ins Haus flüchten, wenn es tröpfelt? So aufgelegt ist die Antwort nach meiner Erfahrung nicht, wie es jetzt scheint. Ich kenn nur wenige, die sich nachts im Wald - ohne Taschenlampe und Smartphonelicht - nicht fürchten. Wir sind Augentiere, im Finsteren um unsere wichtigste Orientierung
Z‘tot
g‘fürcht
is a g‘storbn … sagte meine Großmutter.
beraubt. Anders wieder als mein brauner vierbeiniger Begleiter, er scheint sich auch nachts pudelwohl zu fühlen, läuft nirgends hinein, fällt nirgends runter. Geruchsstraßen sind nicht vom Mondschein abhängig. Nicht nur die Römer hatten Angst vor dem dunklen mitteleuropäischen Wald. In den Märchen der Brüder Grimm ist das der Ort, wo man sich verirrt, von den Eltern ausgesetzt wird, verhungert, in dem der Wolf einen frisst, Hexen, Räuber und Drachen wohnen. Nach dem Schweizer Psychoanalytiker und Freud-Schüler C.G. Jung ein Ort der Ängste und Traumata. Viele Menschen empfinden im Wald vielleicht nicht Angst, aber zumindest Spannung, Bereitschaft zu reagieren, hohe Aufmerksamkeit. Jedenfalls kaum ein sich hingeben und verschmelzen mit Boden und Geräuschen und Wind und Regen. Doch wie real, wie berechtigt ist dieser Zustand?
Analytisch würde ich die Gefahren in biotische (Tiere, Pflanzen und Menschen) und abiotische (Klima, unbelebte Natur) einteilen.
Mit zugegebener Schadenfreunde erinnere ich mich an den US-Austauschstudenten der, mit mir im Wald, versonnen mit der Hand an Brennnesseln entlang strich. Das hat
mich einige Pluspunkte trotz meiner Gastfreundschaft gekostet, dass ich ihn vor so einer gefährlichen Pflanze nicht ausdrücklich gewarnt habe. Noch Stunden später zeigte er mir bekümmert seine Rötung. Brombeer, Disteln, Kletten, Schwarz- und Weißdorn sind nur lästig. Wenn man also keine Pflanzen/Pilze in den Mund steckt, ist die botanische Bedrohung tragbar.
Bei den Tieren würde ich sagen: Je kleiner umso gefährlicher. Je größer umso seltener.
Braunbären: In Slowenien (so groß wie Niederösterreich) leben über 500 Bären, für Oberösterreich wären das 33 dieser Sohlengänger je Bezirk! Gäbe es bei den Nachbarn ernsthafte Probleme, hätten wir das in der Kronenzeitung gelesen. Wie die Slowenen das machen, wäre eine eigene Recherche wert.
Wölfe: Hier bislang keine Gefahr für Menschen (außer für Rotkäppchen). Zutiefst beunruhigend wäre, wenn sich Berichte über Wölfe, die die Scheu vor Menschen verlieren, häufen. Deren Abschuss wäre für mich zwangsläufig. Bitte um Nachsicht, die Konflikte mit Jagd und Landwirtschaft klammere ich hier aus.

Dann werden die gefahrvollen Tiere schon bedeutend kleiner. Kreuzottern sind im Normalfall schmerzhaft, aber nicht tödlich. Ein Hornissennest in der Kanzel? Ich war jedenfalls extrem schnell wieder unten. Auch mehrere Stiche sind keineswegs tödlich bei normaler Gesundheit. Tipp: Nicht mit angezündeter Spraydose dagegen antreten. Wäre nicht die erste Kanzel, die so abbrennt. Wespen, auch Erdwespen sind ähnlich, schmerzhaft, aber nicht mehr. Mein Hund schnappt die Wespen mit dem Fang, zerbeißt sie und spuckt sie aus. Bislang gings gut. Beißende (oder stechende?) Spinnen gibt’s; auch bei Berührung giftige Raupen (z.B. Eichen -Prozessionsspinner). Tragisch bis tödlich kann deren Kontakt für den Hund werden. Kiefern-Prozessionsspinner sind so giftig für die Schleimhäute der Hunde, dass diese abstirbt. Maul, Fang, Rachen… schlimmer als die Fotos auf den Zigarettenpackungen. Die Prozessionsspinner sind kleine helle Schmetterlinge. Die Raupen prozessieren, nicht vor Gericht, sondern sie bilden eine Prozession. D.h. sie hängen sich in einer langen Schlange aneinander wie wir bei Fronleichnam. Noch erscheint diese Schmetterlings-Vorstufe selten in Mengen und wenn, dann meist in wärmeren Gegenden – etwa Gardasee oder Wien, wo sie zum Schutz der Menschen auch mit Insektiziden bekämpft werden.
Tierischen „Kontakt“ hatte schon jeder mit Ameisensäure, Gelsenstichen oder Bremsen im Hochsommer.
Jetzt wird’s kleiner und auch für uns lebensgefährlicher:
Zecken können schwere Erkrankungen und Tod bringen (Borreliose und Gehirnhautentzündung). Beides ist mit Vorsicht vermeidbar oder einfach behandelbar. Beim Menschen gibts vorbeugend, die Impfung gegen FSME bzw. Antibiotika nach Diagnose von Borreliose. Für Hunde gibts gegen Borreliose schon eine Impfung. Je länger die Zecke saugt, umso ansteckender, also: weg damit, schnell, umstandslos. Zecken sind einer der wenigen Umstände, wo mein Hund von der Natur mehr belastet ist als ich. Dank seines kurzen Fells finde ich die Blutsauger leicht, weg damit, schnell. Borreliose kann auch ihn treffen und ist bei Verdacht über ein Blutbild diagnostizierbar. Meist ist es für die Antibiotika-Behandlung dann schon sehr spät. Armer Hund.
Wirklich ungut wird’s bei den Zoonosen: Das sind Bakterien, Viren, Pilze und weitere kleinste Lebewesen, die vom Wild (oder allgemein von Tieren) auf uns übertreten und krank machen, manchmal durchaus drastisch. Ebola, Milzbrand, Tollwut, Covid... reichts? Diese kleinen Stinkerchen sind höchst flexibel und Symptome meist unspezifisch, schwer zu diagnostizieren, daher oft schon weit fortgeschritten. In Wald und Wiese relevant und in letzter Zeit häufiger ist etwa Tularämie und Brucellose bei Jägern, auch in Oberösterreich.
Mäusekot, besonders der, der im Wald lebenden Rötelmaus, kann
Hantaviren enthalten. Diese fliegen durch die Luft, treten durch Wunden oder Atmung in unseren Körper ein und verursachen meist grippeähnliche Symptome, geht aber auch schlimmer. Im Wald wieder sehr unwahrscheinlich, aber bei Mausgeruch in Kanzel und Hütte: Wunden abdecken, feucht wischen, Maske. Wo mein Hund überall schnüffelt ist grauslich, darum gibt’s konsequent keinen Gesicht-Schnauzen-Kontakt. Wie wenig er davon belastet wird (von den erschnüffelten Stinkerchen) ist erstaunlich.
Extreme werden hier nicht berücksichtigt. Ja, es wurden schon Menschen von tollwütigen Rehen oder beleidigten Murmeln gebissen, von Gams von oben mit Steinen bedacht, von Schwänen ertränkt, Hunde von Bibern angefallen und von Adlern entführt.
Kommen wir zur unbelebten Natur. Hochwasser, Eisbruch, Lawinen und Muren, Blitzschlag, Steinschlag (gibt’s Astschlag? Fallende Äste die einen erschlagen?)… ja wenn es mit mir so zu Ende geht, wrong time, wrong place, hoffentlich genug gutes Karma angesammelt.
Die größte Gefahr ist aber der Mensch selbst, und da nicht der andere, der Räuber, der im Busch steckt. Kein Wunder, dass bei uns Räuber ausgestorben sind; so lang warten zu müssen bis endlich wer vorbeikommt. Und dann hat das Opfer nur ein gesperrtes Handy und eine Hundeleine mit. Stolpern über den eignen, vor Freude überschäumenden Hund (Dadlbauer kann das besonders gut), ausrutschen auf den taufeuchten Steinen am Bergsteig, von der Leiter fallen, beim Hochstandmachen mit der Motorsäge schneiden, beim Aufbrechen den eigenen Finger mitschneiden; das ist die Hälfte aller jagdlichen Unfälle. Nach deutschen Zahlen sind dann die Risiken, die von Insekten, der Waffe, dem Hund und dem Auto ausgehen, etwa gleich häufig.
Selbst wenn es mir gelingt, ihren Verstand zu überzeugen, dass unsere „Kultur-Landscape of Fear“ harmlos ist, wird, wenn Sie allein sind, ein Gefühl der Anspannung bleiben, wenn sie sich auf die weitgehend unberührte Natur einlassen. Die Evolution lässt sich nicht so leicht wegdenken. Aus Angst davor zu Hause bleiben, ist keine Alternative. Zitat Oma: „Z‘tot g‘fürcht, is a g‘storbn“.
Haben auch Förster Angst im Wald? Nun, wohl weniger als die meisten Anderen. Aber, als ich auf allen Vieren durch die Buchenverjüngung kriechend beim Forststraßentrassieren plötzlich eine frische Bärenfährte auf Armlänge vor meiner Nase fand, habe ich auch nach den Kollegen gerufen, ob sie noch da sind. Handtellergroß, dreieckige Ferse mit Ballen, fünf Krallen, Hinterpfote! Selbst der sonst so abgeklärte Bezirksförster hat von dem Tatzendruck in weicher Erde einen Gipsabguss gemacht.
Oder Alarm auch, als ich, einziges Menschlein auf mehreren Quadratkilometern, auf einer Hochebene im Apennin mitten am Weg knieend eine Losung untersuchte: Aha, groß wie Hundekot, Schaffellreste, Knochensplitter… das war wohl ein Wolf. Da hab ich auch leicht panisch meinem verschwundenen Hund gepfiffen und ihn angeleint.
Den größten Schrecken erlebte ich, als ich im Waldschacherl im Alpenvorland mit dem Fuß den silbern glänzenden, vermeintlichen Blechdeckel wegschieben wollte. Und sich die Ringelnatter langsam entrollte und noch morgensteif wegschlängelte. Völlig harmlos, aber - stark pochendes Herz, minutenlang. Empfundene Gefährdung und tatsächliche Gefahr sind nicht unbedingt logisch verknüpft. Sonst würden wir auch nicht mehr Autofahren.
Ich denke, dass die Erwartbarkeit, der Wechsel mit Überraschungen und deren Gleichzeitigkeit, die ich beim Jagen erlebe, ein wesentlicher Teil an dem tiefen Erlebnis ist. Ruhiges Sit-
zen und beobachten von bekannten, kalkulierbaren Vorgängen im Umfeld (Sonnenaufgang, kreisende Bussarde, kletternde Kohlmeisen im Geäst, nahende Spaziergeher, langsam ziehendes Gamsrudel, das ruhige Atmen des schlafenden Hundes, …) und dem Registrieren plötzlicher Veränderungen (kreischende Krähen, meldende Amseln, die plötzliche Anwesenheit der Rehe oder deren aufwerfen beim Äsen, das warnende Keckern der Ei
chelhäher…) schafft Spannung. Ohne Anspannung wohl auch keine Entspannung.
Nur gelegentlich kann ich etwa am Waldrand sitzen (natürlich nicht im Dienst!), ganz bei mir und im Hier sein, ohne jegliche Spannung, mich auflösen in der Umgebung, vieles registrieren ohne zu reagieren. So muss wohl das Paradies sein.
BLUMENFELDER IN SEEWALCHEN


In einem besonderen Schulterschluss hat die Bauernschaft gemeinsam mit der Jägerschaft von Seewalchen am Attersee ein Zeichen für Natur und Gemeinschaft gesetzt. Zwischen den Sonnenblumen, die die Bauernschaft schon in den letzten Jahren gesät hat, wurde heuer von den Jägerinnen und Jägern eine spezielle Untersaat eingebracht.
Die Sonnenblumen bieten tagsüber ein freundliches Bild und laden Na-
turnutzer zum Pflücken ein, gleichzeitig profitieren Bienen, Hummeln und viele weitere Insekten von der reichen Blütenpracht und dem unterwachsenen Pflanzenteppich. Und natürlich dient die Wildäsungsmischung weiters dem heimischen Wild als Nahrungsquelle.
Dieses Projekt zeigt eindrucksvoll, wie Landwirtschaft, Jagd und Naturschutz Hand in Hand gehen können.
MIT DEN JÄGERN UNTERWEGS.
WAS MACHEN DIE JÄGER EIGENTLICH SO IM WALD?




Jägerschaft Vorderweißenbach IV (Schönegg) und Lehrerinnen der VS Vorderweißenbach
TEXT: CHRISTINE BUCHINGER
Warum seid ihr grün angezogen? Hast du schon einmal einen Wolf in echt gesehen? Wieso müsst ihr eigentlich Tiere schießen? Wieso muss ich leise sein, wenn ich durch den Wald gehe? Warum habt ihr einen Hund dabei? So viele gute, neugierige Kinderfragen, die auf Antworten warten. In Vorderweißenbach haben sich Jäger und Lehrer deshalb für ein „Schule und Jagd“Pilotprojekt zusammengetan.
Leuchtende Augen, vorsichtige Finger, die durch den Fuchsbalg streichen, den Jagdhund streicheln oder Abwurfstangen untersuchen:
Seit Jahren schon veranstaltet eine kleine Gruppe von Jägern der Gemeindejagd Vorderweißenbach IV (Schönegg) bereits ein Ferienprogramm und immer wieder „Schule und Jagd“-Ausflüge in der Gemeinde. Vergangenes Schuljahr hat man sich dann gemeinsam mit der Volksschule Vorderweißenbach etwas Neues ausgedacht. „Wir wollen – auf Anregung einer unserer Jägerinnen – für die Kinder alters- und schulstufengerechte Stunden bieten, die sich optimal in den Lehrplan eingliedern lassen“, sind sich die Jäger einig. Nach einem Besuch des Ferienpass-Seminars des OÖ Landesjagdverbandesn
(OÖ LJV) war schnell klar: Es sollten nicht nur die dortigen Ideen und Anregungen im Ferienprogramm und bei den Schulklassen aktiv eingesetzt, sondern darüber hinaus gemeinsam mit den Lehrerinnen ein eigener „Schule und Jagd“-Lehrplan gestaltet werden. „Wir haben uns zusammengesetzt und überlegt, welche Inhalte in welcher Schulstufe am besten passen könnten, und haben das mit dem schulischen Lehrplan abgestimmt“, so Volksschuldirektorin Petra Lummerstorfer. Damit entstand ein erstes Programm, das für jeden Jahrgang einen anderen Fokus vorsieht. Themen wie die Kreisläufe der Natur, richtiges Verhalten im Wald, Jagdwissen sowie jagdliche Traditionen sind immer „mit dabei“. Ganz wichtig auch für die gezielte Bewusstseinsbildung und den Abbau von möglichen Vorurteilen: Es werden immer zu Beginn alle Fragen der Kinder – auf Zettel aus einem Hut gezogen – vollständig beantwortet. Durch die weiteren Inhalte, die gezielt aufeinander aufbauen, „wird Gelerntes gefestigt, und es kommt immer was Neues dazu. So lernen die Kinder spielerisch, nachhaltig und sehr umfangreich“, sagt Lummerstorfer.
PILOTPROJEKT: „SCHULE UND JAGD“-LEHRPLAN
Mit diesem ersten „Schule-und-Jagd“Programm haben die Jägerinnen und Jäger im vergangenen Schuljahr bereits Unterrichtseinheiten bzw. Ausflüge für alle acht Volksschulklassen (rund 130 Kinder) veranstaltet. „Die Lehrerinnen waren durchwegs und ohne Ausnahme hellauf begeistert –
und die Schülerinnen und Schüler sowieso“, sagt Lummerstorfer. Deshalb soll jetzt, unterstützt durch die vielen hilfreichen Unterlagen, dem Schulkalender und anderen Drucksorten des OÖ LJV, das bestehende Programm noch verfeinert werden. Das gemeinsame Ziel: Die Lehrerinnen werden noch gezielter bei Unterrichtsthemen rund um Wald, Wiese und Tiere durch die Jägerinnen und Jäger mit Vorab-Materialien, Infos und Anschauungsmaterial unterstützt. „Wir sprechen uns direkt mit den Jägern ab – und sie machen genau dann
mit den Kindern Schule-und-JagdStunden, wenn relevante Themen in der jeweiligen Klasse im Unterricht durchgenommen werden.“
SCHULE UND JAGD – NOCH MEHR AUSBAUPLÄNE
Eine Win-Win-Win-Situation, welche die Jäger aus Vorderweißenbach IV auch noch weiter ausbauen möchten: Nicht nur das Ferienprogramm soll neu konzipiert werden, damit auch die dort eingeplanten Themen eine Ergänzung zum bereits Gelernten in der Schule darstellen. Ge-


meinsam mit dem Kindergarten will man die Jagd auch für die Kleinsten nahbar und greifbar machen, indem einmal im Jahr die Jäger zu Besuch kommen. Denn: Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung, die vielfältig gestaltet, spielerisch ist und früh beginnt, fruchtet am meisten.



LICHTENBERG. 3. und 4. Klasse Volksschule,

ST. GOTTHARD. Ferienaktion, 25.07.2025

EIDENBERG. 3. Klasse Volksschule, 16.05.2025

23.06.2025

ALKOVEN SÜD. EKiZ Wilhering, 17.05.2025

ESTERNBERG. Bärengruppe Kindergarten, 25.04.2025

EGGELSBERG. Ferienprogramm, 10.07.2025
BAD ZELL. 2. Klasse Volksschule,

GRÜNBACH. Ferienaktion, 18.07.2025



HÖRSCHING. 3. Klassen Käthe-Reicheis-VS, 18.06.2025

Ferienaktion, 28.07.2025

MÜNZBACH. 3. Klasse Volksschule, 06.06.2025
MICHELDORF.
KIRCHHAM. 3. und 4. Klasse Volksschule, 20.06.2025
NAARN. 2. Klasse Volksschule, 13.06.2025

REICHERSBERG. 3. Klasse Volksschule, 28.04.2025

NEUMARKT I. M. 2. Klasse Volksschule, 06.06.2025

NIEDERTHALHEIM. 4. Klasse Volksschule, 23.05.2025

SCHIEDLBERG. Volksschule, 18.6.2025

NIEDERKAPPEL. Ferienaktion, 25.07.2025

NIEDERWALDKIRCHEN. Ferienprogramm, 10.07.2025

SCHWANENSTADT. 4d Volksschule, 26.06.2025



SEEWALCHEN AM ATTERSEE. 4. Klasse Volksschule, 26.06.2025


ST. THOMAS. 3. und 4. Klasse Volksschule, 09.05.2025
ST. AGATHA. Ferienpassaktion, 09.07.2025
TRAUNKIRCHEN. 3. Klasse Volksschule, 23.06.2025
TREUBACH. 3. Klasse Volksschule, 23.06.2025

UNTERWEITERSDORF. 2. Klasse Volksschule, 14.05.2025

WINDHAAG BEI FR. Ferienpass, 25.07.2025

RIEDAU. 3. Klasse Volksschule, 23.06.2025

WAIZENKIRCHEN. Kindergarten Hasengruppe, 23.05.2025

WAIZENKIRCHEN. 3. Klasse Volksschule, 29.03.2025

WAIZENKIRCHEN. Ferienaktion, 11.07.2025

KRONSTORF. 1. und 2. Klasse Anton Bruckner Volksschule, 07.04.2025

NEUKIRCHEN A. D. VÖCKLA. 3. Klassen Volksschule, 12.06.2025

NEUMARKT I. HAUSRUCKKREIS. 3. und 4. Klasse Volksschule, 27.06.2025

NATURVERBUNDENHEIT
Bewahrung unserer Landschaft und Traditionen.

STEINBACH A. D. STEYR. Ferienprogramm der drei Gemeinden Steinbach, Grünburg und Molln, 19.07.2025

WALDHAUSEN. Ferienaktion, 19.07.2025
PRÜFEN SIE IHR WISSEN
Richtige Antworten
1: b, c, e
Die Weitengefährdung für Menschen ergibt sich aus dem Schrotkorndurchmesser in mm x 100. So ist zum Beispiel der Weitengefährdungsbereich einer Schrotpatrone mit 3 mm Schrotkorndurchmesser 3x100 = 300 m. Durch die Flächenverteilung der Schrotgarbe kommt es mit zunehmender Entfernung zu einer nicht unwesentlichen Breitengefährdung, die innerhalb des Weitengefährdungsbereiches bis zu 150 m oder sogar noch mehr betragen kann.
Durch harte Gegenstände wie Steine, gefrorener Boden, hartes Holz (Akazien) oder Metallsteher (wie sie in Weingärten häufig der Fall sind), können Schrote abprallen und demnach auch in einem größeren Abgangswinkel eine Abprallgefährdung darstellen. Stahl- oder Alternativschrote besitzen aufgrund des härteren Schrotkornmaterials eine höhere Abpralltendenz als Bleischrote.
2: d
Wird ein Schuss in einem Winkel von 30 – 35 Grad abgegeben, erreicht das Geschoss seine maximale Schussweite. Diese Höchstschussweite beim Büchsenschuss ist zugleich der für Mensch und Tier tödliche Gefährdungsbereich .22 l.f.B. (Kleinkaliberpatrone) bis 2000m Pistolen- oder Revolverpatronen bis 2000m Flintenlaufgeschosse bis 2000m Jagdbüchsenpatronen Standardkaliber bis 5000m Hochrasanzpatronen (v0 über 1000m/s) über 5000m
3: d
Der Begriff „Freiflug“ bezeichnet dabei die Strecke des rotationslosen Geschossweges, auf dem sich das Geschoss nicht mehr im Hülsenhals befindet, ohne aber in die Felder (erhabene Teile im Lauf) eingepresst worden zu sein.
4: f
Eine geladene Waffe ist immer gefährlich. Absolute Sicherheit gewährleistet nur eine ungeladene Waffe.
Es gibt aber verschiedene Arten, wie bei einer Waffe die ungewollte Schussabgabe verhindert wird.
Nach der Konstruktion unterscheiden wir bei den Sicherungssystemen zwischen direkten Sicherungen und indirekten Sicherungen. Direkte Sicherungen sind Handspannsysteme (Handspannvorrichtungen), z.B. Waffen mit Einschlosssystemen oder Mehrschlosssystemen. Hiebei wird (werden) die Schlagfeder(n) erst unmittelbar vor dem Schuss, in der Regel mittels Spannschieber, gespannt. Vorteile: sie gewährleisten höchste Sicherheit beim Führen der geladenen Waffe, da die Schlossfeder(n) nicht unter Spannung steht (stehen) und somit eine ungewollte Schussauslösung bei Stoß, Sturz oder Fall der Waffe ausgeschlossen wird. Nachteile: bei einigen Modellen muss bei schnellen Schussfolgen der Spannschieber nach dem Nachladen erneut betätigt werden. Bei indirekten Sicherungen wie Abzugsicherung, Stangen- und Fangstangensicherung, Schlagfedersicherung, Schlagstücksicherung und Schlagbolzensicherung werden bestimmte Schlossteile der gespannten Waffe (gespannten Schlagfeder(n)) durch Betätigung eines Sicherungsschiebers oder Sicherungsknopfes blockiert. Vorteile: nach dem Nachladen muss (müssen) die Schlagfeder(n) nicht mehr separat gespannt werden. Dies ist vorteilhaft bei größeren Schussfolgen. Nachteile: keine absolute Sicherheit, da die Schlagfeder(n) unter Spannung steht (stehen) und durch technische Defekte oder durch Erschütterungen die Sicherungsfunktionen außer Kraft gesetzt werden können.
5: d
Von einem Nachbrenner (Versager) spricht man, wenn der Schuss nicht unmittelbar beim Abfeuern der Waffe bricht. Diese Verzögerung kann mehrere Sekunden betragen. Die Ursachen können eine überalterte Munition, schadhaftes Zündhütchen oder feuchtes Pulver sein. Waffe sofort absenken und gegen einen sicheren Kugelfang (gewachsene Erde) richten. Der Verschluss darf unter keinen Umständen sofort geöffnet werden, da ansonsten eine schwere Verletzung (Augen) wegen des Gasdruckes möglich ist.
Quellennachweis: Jagdprüfungsbehelf, 20. vollständig überarbeitete, erweiterte und neu gestaltete Auflage, Österreichischer Jagd- und Fischereiverlag Der Leitbruch, Jagd im 21. Jahrhundert, 1. Auflage 2015, Steirischer Jagdschutzverein, Tummelplatz 7, 8010 Graz Heintges Lehr- und Lernsystem GesmbH, Sicher durch die Jägerprüfung, Waffen und Munition, 40. Auflage 2024
HUNDE-. WESEN.


Geschäftsführer: Andreas Unterholzer
4786 Brunnenthal · Steingasse 3, Tel. 0664/15 19 248
E-Mail: info@sauwalder-jagdhunde-club.at www.jagdhunde-club.at
BRINGTREUEPRÜFUNG
29. März 2025 in Kopfing
Prüfungsleiter: Mf. Franz Reinthaler
Name des Hundes G Rasse Hundeführer
Aron vom Schreiner Weiher R DDR Walter Hauser
Anton vom Schreiner Weiher R DDR Gerhard Fuchs
Aiko vom Schreiner Weiher R DDR Bernhard Wagner
Arko vom Schreiner Weiher R DDR Franz Eggertsberger
Axl vom Schreiner Weiher R DDR Rainer Edelmann
Unka von Hubertus H DK Jonas Steininger
Andra vom Kochbach H DDR Johann Mayr
Opal zi Stalu H PP Maximilian Feichtinger
Aida vom Schreiner Weiher H DDR Josef Eder
Akela vom Voralpenblick H GRMÜ Johannes Ramaseder
Hera von Claudabeni H DK Alois Froschauer



INNVIERTLER
JAGDGEBRAUCHS-HUNDEKLUB
Geschäftsstelle: Jochen Mühlböck, 4926 St. Marienkirchen/H., Hatting 13 Tel. 0664/1551200
E-Mail: jochen.muehlboeck@aon.at
PRÜFUNGEN SSP, SPFS UND SPFSoR
21. Juni 2025 in Eberschwang
Prüfungsleiter: OSR Franz Lobmaier
Ergebnis SSP:
Preis/Pkt. Name des Hundes Rasse Hundeführer 2a/50 Be my Luckone Alpinflats FCR Felix Riefler
Ergebnis SPFS:
Preis/Pkt. Name des Hundes Rasse Hundeführer
1a/64 Vill vom Grasnitzbründl DK Florian Schachinger
2a/54 Baron v.d. Pfälzer Jagdkönigin DDR H. P. Schrattenecker
Ergebnis SPFSoR:
Name des Hundes Rasse Hundeführer
Dragunow od Kutilky KD Günther Schmiedhuber
Octavio vom Wambacherberg KD Susanne Reschenhofer
Gonzo von St. Marienkirchen MVK Günter Gadermaier
Era z Nerádova Stavení CF Walter Reif
Bea vom Tauschmannhof KlMÜ Eva Dürnberger
Dina von der Stellwand HS Philipp Braumann

Günther Schmiedhuber, Prüfungssieger SPFoR



ÖSTERREICHISCHER CLUB FÜR DEUTSCHE JAGDTERRIER
Obmann: Ing. Christian Grill Hainingerbach 16, 4863 Seewalchen Telefon: 0664/4248166 www.jagdterrier.at
SCHWEISS-SONDERPRÜFUNG
10. Mai 2025 in St. Peter am Wimberg
Prüfungsleiter: Ewald Hammer
Von 4 angetretenen Gespannen konnten 3 die Prüfung erfolgreich bestehen.

ANLAGENPRÜFUNG

10. Mai 2025 in St. Peter am Wimberg
Prüfungsleiter: Otto Stöttner
Formwertrichter: Ing. Christian Grill
Von 8 angetretenen Gespannen konnten 8 die Prüfung erfolgreich bestehen.
BRAUCHTUM &. JAGDKULTUR.


ÜBERLIEFERTER BRAUCH IN NEUER ZEIT
Wie werden der Jäger und die Jägerin bei der Jagd oder bei jagdlichen Veranstaltungen von der Gesellschaft wahrgenommen?
DAS STRECKENLEGEN
TEXT: BJM RUDOLF KERN, VORSITZENDER IM UNTERAUSSCHUSS FÜR JAGDLICHES BRAUCHTUM; FOTO: CH. BÖCK
Das Legen der Strecke nach einer erfolgreichen Jagd empfinden viele Jägerinnen und Jäger als eine der tiefgreifenden Augenblicke des Jägerdaseins. Besonders bei den ersten erlegten Stücken wird bewusst, dass man der Natur ein Geschöpf entnommen und den Tötungsakt gesetzt hat.
Diese Streckenlegung des Einzelnen mit dem erlegten Stück beginnt eigentlich mit der Gabe des letzten Bissens und dem Anstecken des Beutebruches, den man am erlegten Stück symbolisch mit Schweiß benetzt. Auch hier ist es angebracht, das erlegte Stück auf die rechte Körperseite zu legen.
Besonders wenn man eine Jungjägerin oder einen Jungjäger auf ein erstes Stück führt, sollte man sich für diese überlieferte Zeremonie Zeit
nehmen und auf keinen Fall hastig agieren. So manches schnell gefertigte Foto zeigt die Fehler auf.
VERHALTEN GEGENÜBER ERLEGTEM WILD UND BEI DER STRECKENLEGUNG
Wie gegenüber einem lebenden Wildtier verhält sich der anständige, also weidgerecht, agierende Jäger, auch vor erlegtem Wild mit größtem Respekt. Das heißt, achtungsvoll und mit angemessenen Bewegungen. Dabei ist das gleiche Maß anzuwenden, egal ob es sich um eine reine Raubwild-, Niederwild- oder Schalenwildstreckenlegung handelt!
Laute Worte sind dabei ebenso wenig angebracht, wie über das Wild oder die Strecke zu steigen.
WIE WIRD STRECKE GELEGT?
Gestrecktes Wild kommt auf seiner rechten Körperseite zu liegen.

Nach Gesellschaftsjagden wird folgendermaßen Strecke gelegt:
Schalenwildstrecke:
Rot-, Gams-, Reh- und Muffelwild, Sauen und danach Füchse.
Wobei innerhalb der einzelnen Wildarten nach Stärke gereiht wird.
Niederwildstrecke:
Zuerst Haarwild, also Fuchs, Hase und Kaninchen, danach das Federwild beginnend mit Fasan und Ente. Der Übersichtlichkeit halber wird jedes zehnte Stück ein wenig vorgezogen.
Bei gemischten Strecken reiht Schalenwild vor Niederwild.
Die Aufstellung der Jägerinnen und Jäger an der Strecke
Der Jagdherr bzw. der Jagdleiter begibt sich mit den Jägern vor die Strecke, die Jagdgehilfen, Hundeführer und Jagdhornbläser stehen hinter der Strecke.
Alle Jägerinnen und Jäger tragen ihren Hut!
Nach der Ansprache des Jagdherrn oder Jagdleiters wird die Strecke verblasen. Einer der Jagdgäste bedankt sich im Namen aller für den Jagdtag, worauf sich die gesamten Mitfeiernden zum Schüsseltrieb begeben.

VON GAFLENZ NACH WIEN

Inmitten des historischen Ambientes von Hofburg und Heldenplatz eröffneten die Jagdhornbläser aus Gaflenz mit kräftigen Signalen am 30. Mai 2025 die „OÖ. Sommerfrische in Wien“.
Landeshauptmann Thomas Stelzer hob in seiner Eröffnungsansprache die große Bedeutung jagdlichen Brauchtums für Kultur und Regionalität hervor. Bezirksjägermeister Rudolf Kern ließ es sich nicht nehmen, die Gaflenzer Jagdhornbläser
auf der Bühne vorzustellen und ermöglichte dem begeisterten Publikum bei sommerlicher Stimmung Einblicke in den Brauch des Jagdhornblasens, als Teil der OÖ. Volkskultur.
Die Veranstaltung war Teil eines vielfältigen Sommerprogramms, das die Vielfalt Oberösterreichs in die Bundeshauptstadt bringt.
NEUE JAGDKAPELLE IN HANDENBERG

Am 14. Juni begann die Einweihungszeremonie mit dem festlichen Einzug der Jäger und der geladenen Gäste gefolgt vom Hörnerklang der Jagdhornbläser Adenberg aus Handenberg.
Jagdleiter Gottfried Rettenbacher und Bezirksjägermeister Johann Priemaier hielten kurze Ansprachen, in denen die Gemeinschaft und die Verbundenheit der Jägerschaft mit der Natur im Vordergrund standen. Ein Höhepunkt der Feier war die Segnung der Kapelle durch Pfarrer GR Pater Silvius.
Die Kapelle wurde mit viel Eigenleistung der örtlichen Jägerschaft unter Mithilfe ortsansässiger Handwerker errichtet. Sie ist ein Symbol für die enge Gemeinschaft der Jäger zum Schutz der heimischen Tierwelt.
JHBG Gaflenz mit LH Thomas Stelzer und BJM Rudolf Kern
Foto:
Flügelschlag
Fotografie by Michaela Weiß
MILITÄRMUSIK TRIFFT JAGDHORNBLÄSER

Die OÖ Militärmusik spielte am 25. Juni 2025 unter der Leitung von Militärkapellmeister Obstl. Gernot Haidegger ein Konzert im Schloss Orth in Gmunden. Haidegger hatte die Idee, Jagdhornbläser als GastMitwirkende einzuladen.
Über Musicaldarstellerin und Sängerin Veronika Riedl, Tochter von Landesviertelobmann Hubert Riedl wurden 28 Jagdhornbläser der Jagdhornbläsergruppen Garsten, Aschach/Steyr und Ternberg rekrutiert. Sie probten unter Riedls Leitung für die Stücke „Freischütz“-Themen Potpourri und „The Law of the Mountain Hunt“ von A.O. Sollfelner. Die Bläser spielten auf den überdachten Gängen des Schlosses auf, während das 60 köpfige Orchester der Militärmusik unten im bis auf den letzten (Steh-)Platz gefüllten Innenhof musizierte. Haidegger lobte die Jagdhornbläser im Nachhinein
für ihr „sauber geblasenes“ und „aus einem Guss“ dargebotenes Spiel.

UM 1850

Mit den Meerschaumpfeifen fand der Pfeifenkult seinen Höhepunkt. Ihre meist kunstvoll geschnitzten Köpfe erforderten sehr viel Geschicklichkeit des Schnitzers. Meerschaum, auch Sepiolith genannt, ist ein weiches, weißes Mineral (wasserhaltiges Magnesium-Silikat). Es hat die Fähigkeit, die Temperatur des Rauches zu reduzieren. Durch den Tabakrauch erhält die Pfeife eine rötlich-braune Farbe, je dunkler sie wird desto stolzer ist der Besitzer.
Die Verfärbung lässt sich aber nicht vorhersagen und ist bei jeder Pfeife unterschiedlich.
ÖFFNUNGSZEITEN: Ostern (Karsamstag) bis 31. Oktober: Montag bis Sonntag, von 10:00–12:00 und von 13:00–17:00 Uhr; Freitag Nachmittag geschlossen!
DER KNOCHENKÜNSTLER
Die faszinierenden Kreationen eines Hornschnitzers
Gerhard Götzendorfer ist Österreichs einziger Hornschnitzer. Was macht er genau? Warum eignet sich nicht jedes Wildgeweih für seine Kunstwerke? Und warum hält er seine Werkzeuge so geheim?
Einmal im Jahr ist der Hirsch oben ohne. Das heißt, er steht plötzlich ohne sein prächtiges Geweih da. Grund dafür ist der sogenannte „Geweihabwurf“. Der findet immer im Spätwinter statt, also meist im Februar oder Anfang März. Grund dafür

ist der Tiefstand des Sexualhormons Testosteron. Der bewirkt, dass die Knochensubstanz des Hirsches zerstört wird – und das Geweih plötzlich von alleine abfällt. „Der Zufall will es, dass die Hirsche ihr Geweih oft während der Fütterung verlieren“, erklärt Gerhard Götzendorfer. Diese findet meist in Futterkrippen statt, die von JägerInnen betreut werden. Warum
im Winter gefüttert wird? Weil die natürlichen Winterlebensräume des Wildes in den besiedelten Tieflagen vom Menschen beansprucht werden und zugleich Wintersportaktivitäten zusätzliche Beunruhigung bringen und damit dem Wild mehr Energie abverlangen. Energie, welche sich das Wild aus der Umgebung, den Bäumen zum Überleben holen muss. „Dadurch, dass die Hirsche oft nicht weit von der Futterkrippe entfernt ihr Geweih verlieren, ist es für die JägerInnen ein Leichtes, die Geweihe zu sammeln. Ich kaufe sie ihnen dann ab.“
Gerhard Götzendorfer ist Österreichs einziger hauptberuflicher Hornschnitzer. In seiner kleinen Werkstatt im oberösterreichischen Oberweis schnitzt der 57-Jährige allerlei aus Wildgehörn: Knöpfe, Messergriffe, Ringe, Trachtenschmuck – und überhaupt alles, was an Auftragsarbeiten so anfällt. Aber wie genau funktioniert die Hirschhornschnitzerei?
FEINSTE KNOCHENMINIATUREN
Theoretisch kann man mit jedem Gehörn schnitzen. Und auch Götzendorfer schnitzt regelmäßig mit Reh, Steinbock oder Gams. „Aber am allerliebsten ist mir der Rothirsch“, sagt er. Warum? „Weil die Knochendichte seines Geweihs schlichtweg hervorragend ist. Diese Dichte ist im besten Fall mit der von Elfenbein vergleichbar. Und je dichter ein Knochen ist, desto besser lässt er sich schnitzen, weil ich dadurch unglaublich fein ins Detail gehen kann.“
Und tatsächlich sind manche von Götzendorfers Kunstwerken an Feinheit nicht zu überbieten. Wie zum

Beispiel der „Rosenstockknopf“, der so heißt, weil es sich dabei um einen geschnitzten Rosenstock handelt, dem Ansatz des Hirschgeweihs also: Auf fünf Zentimetern ist da linkerhand ein Jäger mit Gewehr zu sehen, in der Mitte ein Baum, rechts ein Strauch, und am Rand schließlich ein Hirsch mit prächtigem Geweih. Ja, selbst ein drei bis vier Millimeter kleines Jagdhündchen zu Füßen des Jägers bringt Götzendorfer in diesem Rosenstockknopf unter. Und was ist mit dem Steinbock? „Der wirft nicht ab“, erklärt der Schnitzer, „dadurch bilden sich in seinem Horn Wachstumsfasern, wie bei einem Baumstamm. Das heißt, ich kann halt nicht so ins Detail gehen.“ Wie geht der Knochenkünstler beim Schnitzen genau vor?
WORAUF KOMMT ES BEIM SCHNITZEN AN?
Von jedem Geweih werden lediglich die äußeren vier Millimeter verarbeitet. Der Rest des Knocheninneren ist nicht dicht genug und daher für den Schnitzer nicht nutzbar. Viel über seine Techniken verraten will Götzendorfer nicht. Zu groß ist seine Angst, jemand könnte das, was er sich über drei Jahrzehnte hart erarbeitet hat, ungefragt übernehmen und als Hobbyschnitzer günstiger anbieten. „Außerdem“, sagt er, „sind meine Werkzeuge alle selbstgemacht. Ich
HUBERTUSMESSE
wüsste nicht einmal, wie die genau heißen.“ Ganz kleine, feine, aber scharfschneidende Eisendinger sind das, auf die Götzendorfer kurz einen Blick werfen lässt.
Das einzige Werkzeug, aus dem der Hornschnitzer kein Geheimnis macht, ist seine Laubsäge. „Das ist ja auch das, was die oberösterreichische Hornschnitzerei von allen anderen weltweit unterscheidet“, sagt er. „Die Schnitzereien werden mit der Laubsäge ausgeschnitten und nicht, wie sonst überall, gefräst.“ Und wie
sieht es innerhalb Österreichs aus? Inwiefern unterscheiden sich die oberösterreichischen Hornschnitztechniken von denen in, sagen wir, Niederösterreich? „Das weiß heutzutage, glaube ich, niemand mehr“, sagt Götzendorfer. „Ich bin ja der Letzte, der das noch hauptberuflich in Österreich macht. Damit droht diese Tradition bald verloren zu gehen. Außer, es kommen bald Junge nach.“
Mit bestem Dank an Jagdfakten.at
BEI DER JAGABILDKAPELLE AM HAUGSTEIN

Mag Franz Salcher in seiner Predigt:“…Halt, Schutz, Geborgenheit, Heimat ist auch für unser Zusammenleben entscheidend. Je mehr wir in der Jägerschaft, Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Nachbarschaft nicht gegeneinander wirken, sondern aufeinander zugehen, umso mehr können wir einander Zuflucht, Stütze, Halt und Hilfe geben.“
Am Sonntag, den 22. Juni, versammelten sich mehr als 150 Jägerinnen, Jäger sowie naturverbundene Gäste zur traditionellen Hubertusmesse bei der Jagabild-Kapelle am Haugstein. Musikalisch umrahmt wurde die Feier von den Pramtaler Jagdhornbläsern.
Landesjägerpfarrer Mag. Franz Salcher hielt die Messe und hob in seiner Predigt die Wichtigkeit der Gemeinschaft hervor: Rund um die gut gepflegte Kapelle am Haugstein stehen große, alte Buchen, Fichten, Tannen.
Im Wurzelwerk sind sie ineinander verzweigt und verbunden. Sie geben
einander Halt, Schutz und Beständigkeit.
Bezirksjägermeister Alois Selker dankte der Engelhartszeller Jägerschaft für die beständige Pflege der Kapelle und Elisabeth Bauer, die mit viel Engagement die Chronik des Jagabildes mit allen verstorbenen Jägern des Bezirkes führt und damit wertvolle Erinnerungen und Tradition bewahrt.

Was wollten Sie schon immer über die Jagd wissen? fragen-zur-jagd.at
SCHIESS-. WESEN.

FAKTEN IM ÜBERBLICK
BLEI (FREIE) MUNITION
BEI DER HERBSTJAGD ?!
TEXT: MAG. BENJAMIN ÖLLINGER FOTO: C. NEUNTEUFEL

WELCHE REGELUNGEN GELTEN BEI DER VERWENDUNG VON BLEISCHROTEN?
Bei der Jagd auf Wasservögel wie z.B. Stockente, Krickente, Reiherente, Tafelente, Blässhuhn, Graugans öder Höckerschwan ist die Verwendung von bleihaltiger Schrotmunition aufgrund einer chemikalienrechtlichen
Verordnung verboten. Bei der Jagd auf Feldhase, Fuchs, Steinmarder, Baummarder, Waldiltis, Fasan, Waldschnepfe, Rebhuhn usw. ist die Verwendung von bleihaltiger Schrotmunition aufgrund jagdrechtlicher Vorgaben in der Nähe von Gewässern bzw. Feuchtgebieten eingeschränkt.
Was ist zu beachten?
Der Geltungsbereich der jagdrechtlichen Einschränkung bezieht sich auf sogenannte Feuchtgebiete. Die Verwendung von bleihaltigem Schrot sowie das Mitführen von bleihaltigem Schrot, wenn nicht dargelegt werden kann, dass diese Munition nur außerhalb der Feuchtgebiete verwendet
wird, ist in Feuchtgebieten und in einer Pufferzone 100 Meter rund um Feuchtgebiete verboten.
WAS IST EIN FEUCHTGEBIET?
Als Feuchtgebiete gelten dauernde Gewässer wie z.B. Seen, Teiche, Flüsse etc. und zeitweilige Gewässer. Feuchte Sutten, zeitweise überschwemmte Feuchtwiesen, Salzlacken oder Moore stellen, unabhängig ob in der Trocken- oder Feuchtperiode, ebenfalls solche Verbotszonen dar. Größere oder kleinere Wasserlacken nach einem Regenguss sind allerdings nicht von diesem Begriff umfasst.
WER KONTROLLIERT DIE EINHALTUNG DER
BESTIMMUNGEN?
Die chemikalienrechtlichen Verbote kontrollieren die Chemikalieninspektoren des Landes. Die jagdrechtlichen Einschränkungen kontrollieren die örtlich verantwortlichen Jagdschutzorgane.
Was muss ich beachten?
Bei den anstehenden herbstlichen Treibjagden sollte bereits bei der Begrüßung und Instruktion vor Beginn
Frühbezugsaktion Wildfutter
der Jagd auf diese Bestimmungen, Einschränkungen und Verbote beim Mitführen von Bleischrot hingewiesen und sowohl Munition und Waffen kontrolliert werden (z.B. durch aktives Vorzeigen). Es soll auch klar und eindeutig kommuniziert werden, wo im Revier bzw. bei welchen Trieben oder bei welchem Stand mit Bleischrot gejagt werden darf und wo nicht.
VERSTÄRKTER BESCHUSS AUS SICHERHEITSGRÜNDEN
Wird bei der Jagd sog. Stahlschrot verwendet, wird die Flinte im Regelfall ein entsprechendes Beschusszeichen („Lilie“) aufweisen (müssen). Je nach Kaliber gelten hier unterschiedliche Vorgaben für Chokebohrung, Gasdruck und (maximale) Größe der Stahlschrote. Auch die Deckung der Schrotgarbe ist eine andere. Ein Besuch beim Büchsenmacher im Vorfeld ist daher empfehlenswert.
Wie kann ich mich vorbereiten?
Nachdem in Oberösterreichs Schießstätten (im Freigelände) regelmäßig der Einsatz beider Munitionsarten zulässig ist, sollte Teil der Vorbe-
reitung jedenfalls das praktische Schießtraining mit Blei- und Stahlschrotmunition z.B. auf Wurftauben oder Zielscheiben mit Feldunterteilungen sein. Das Distanzgefühl und das Gefühl für die unterschiedliche Deckung des Schusses – durch die Beurteilung bzw. die Auswertung der Verteilung der Schrotgarbe – mit unterschiedlichen Schrotmaterialien werden somit gestärkt.

WEITERE INFORMATIONEN
Weitere (detaillierte) Ausführungen zum Thema „Bleischrot in Feuchtgebieten“ sind auf der Homepage des Oö. Landesjagdverbands im Bereich News – Aktuelles – Informationen zum Bleischrotverbot in Feuchtgebieten zu finden.
Beitrag im OÖ JagdTV:

BEZAHLTE ANZEIGE

DAS LOS MIT DEM LOS
Nicht jede Patrone ist ein 100-prozentiger
Klon der vorigen Patrone
TEXT: KARL FROSCHAUER
FOTOS: K. FROSCHAUER, SHUTTERSTOCK
Heute beschäftigen wir uns zur Abwechslung einmal nur mit dem „Futter“ unseres Werkzeugs – mit der Munition.
Wir leben in gesegneten Zeiten was Waffen und Munition angeht. Noch nie in der Vergangenheit war es möglich, so hochwertige Waffen und Munition zu einem leistbaren Preis und in marktkonformen Mengen herzustellen. Aber eines ist sicher: nicht jede Patrone ist ein 100-prozentiger Klon der vorigen Patrone. Die Hersteller haben es heute schon sehr gut im Griff, jedoch wird auch jetzt noch in Losen (unterschiedliche Größe)
produziert. Man kann sich heutzutage sicher sein, dass alle Patronen aus einem Los nur geringste Abweichungen zu den anderen Patronen aus gleichem Los haben.
DIE BESTANDTEILE DER MUNITION UND MÖGLICHE PROBLEME
Wir beginnen einfach ganz „vorne“, beim Geschoss, gleich dahinter befindet sich das Treibladungspulver (heute durchwegs auf Nitrozellulosebasis), umschlossen wird alles von der Hülse (hauptsächlich aus Messing bei Büchsenpatronen) und am
Ende unserer Patrone sitzt das Zündhütchen (meist Boxerzündung).
Die Munitionshersteller verwenden in jedem Munitionslos auch nur (oben aufgeführte) Komponenten, die selbst wieder nur aus einem Produktionslos kommen und gewährleisten somit eine ordentliche Gleichmäßigkeit.
Wo liegen aber die Probleme, die uns Jäger direkt betreffen? Geschosse können geringfügig variieren, dies ist dem Herstellungsprozess geschuldet.
Die Hülsen haben ebenfalls von Los zu Los kleine Abweichungen, sei es in der Legierung, dem Volumen, der

Produktion selbst, der Materialhärte, dem Ausziehwiderstand, Zündloch und weitere kleine Unterschiede. Das Zündhütchen mag auch immer wieder eine (wenn auch geringe) Rolle spielen, wobei manchmal auch die Hersteller oder Lieferanten gewechselt werden können. Den größten Einfluss in der Munitionsherstellung hat mit Sicherheit das Pulver – dies wird durch chemische Prozesse hergestellt, welche immer wieder unterschiedliche Endprodukte hervorbringen, die vom Pulverhersteller (nicht immer der Munitionshersteller selbst) dann aus mehreren Produktionsläufen entsprechend abgemischt werden („blending“) bis das jeweilige Pulver in seinen Eigenschaften dem vorigen Los sehr ähnlich ist. Munitionshersteller haben auch völlig eigene Mischungen von Pulvern, wie sie nicht auf dem freien Markt erhältlich sind. Diese werden nach deren Spezifikationen geblendet und in passender Menge je nach Größe des Produktionsloses der Munition an die Hersteller geliefert. Der Munitionshersteller verlädt in letzter Instanz dann diese vielen Komponenten und testet auf gleichmäßige Geschossgeschwindigkeit und deren geringe Abweichung von
Schuss zu Schuss und auch die Abweichung der Geschwindigkeit zum vorigen Los muss innerhalb einer gewissen Toleranz liegen. Durch Anpassen der Pulvermenge wird dies gewährleistet. Sind die Ergebnisse zufriedenstellend, wird noch die Präzision allgemein geprüft. Hier wird aber nicht getestet, ob der gleiche Treffpunkt eingehalten wird – dies ist dem Hersteller auch nicht möglich, da er ja nur aus den eigenen Testläufen und Testwaffen schießen kann.
Wenn all diese Schritte abgeschlossen sind, wird die Munition einem amtlichen Beschuss nach den Regeln der C.I.P. unterzogen, damit der Endkunde sicher sein kann, dass die gekaufte Munition den gültigen Standards bei Dimension und Druck entspricht.
WAS MUSS BEIM MUNITIONSKAUF BEACHTET WERDEN?
Wenn wir neue Munition kaufen, also ein neues Los bekommen, so ist ZWINGEND die Treffpunktlage aus der eigenen Waffe zu überprüfen, auch wenn wir wieder das gleiche Produkt gekauft haben. Ein neues bzw. anderes Los kann nämlich deutliche Abweichungen haben. Sind vom alten Los noch ein paar Patronen übrig, so lässt sich damit auch ohne Probleme die eigene Fertigkeit mit der Büchse am Schiessstand trainieren, denn etwas Übung hat noch Niemandem geschadet. Es empfielt sich also, immer zumindest einen Jahresvorrat der gewünschten Munition anzuschaffen oder besser noch gleich 100 oder 200 Schuss aus gleichem Los.


JÄGERSPRACHE von A – Z
EISSPROSSZEHNER
Ein Rothirsch weist an jeder Stange eine Gabel und eben einen Eisspross auf, also fünf Enden: Aug-, Eis-, Mittelspross und Gabel.
FEISTZEIT
Bei männlichem Rotwild die Periode zum Aufbau der Energiereserven vom Ende der Kolbenzeit (Abschluss d. Geweihwachstums) bis Eintritt in die Brunft. Beim Rehwild bezieht sich diese auf den Herbst, von September bis November, in der eine Fettschicht als Energiereserve für den Winter angeäst wird.
GEÄSE
Das Maul des Hasen.
GESTÜBE(R)
Losung des z.B. Rebhuhns.
INFANTERIST
Laufender Fasan – Flinte weg, außer Fangschuss!
ORGELN
Ein tiefes, gutturales Brüllen und Schnaufen der Hirsche; diese schreien, orgeln, röhren, trenzen, knörren, melden gut oder schlecht, verschweigen. Tiere mahnen.
STROH'SCHES ZEICHEN
Beim jungen Hasen spürt man an der Außenseite der Vorderläufe knapp oberhalb des Handwurzelgelenks einen etwa erbsengroßen Knoten.
TRACHT
Gebärmutter des Haarwildes; auch der Embryo.
AUS DEN. BE ZIRKEN.

MÜHLVIERTLER BEZIRKSJÄGERFRÜHSCHOPPEN

Am Sonntag, den 22. Juni, fand bei herrlichem Sonnenschein der Mühlviertler Jägerfrühschoppen im malerischen Schnopfhagen-Stadl statt. Die Veranstaltung der Bezirksjagdgruppe Urfahr-Umgebung lockte zahlreiche Jägerinnen und Jäger sowie Freunde der Jagd an. Der BrauUnion-Bieranstich durch Nationalrat Michael Hammer und Hauptorganisator Bezirksjägermeister Sepp Rathgeb wurde durch die Jagdhornbläsergruppe Altenberg musikalisch umrahmt.
Ein besonderes Highlight war der feierliche Jungjägerschlag. 40 frischgebackene Jungjägerinnen und Jungjäger wurden von Bezirksjägermeister Rathgeb und dem Landesobmann für
jagdliches Brauchtum, Bezirksjägermeister von Steyr, Rudolf Kern, nach traditionellem Ritus in die Jägerschaft aufgenommen.
Zugleich wurde auch Otto Scheuchenstuhl aus Alberndorf als ältester Jäger für seine jagdliche Treue mit dem brandneuen Abzeichen „80-jährige Mitgliedschaft im OÖ. Landesjagdverband“ ausgezeichnet.
Zahlreiche Ehrengäste wie Landesbäuerin Johanna Haider, Bezirksbauernkammerobmann Peter Preuer, Gemeindejagdvorstand Johann Rammerstorfer, Bezirkshauptmann Ferdinand Watschinger, die Bürgermeister Martin Tanzer (Alberndorf i.d.R.), Thomas Prihoda (Goldwörth)
und Johann Plakolm (Walding) sowie die beiden Vizebürgermeisterinnen Elisabeth Haiböck (Bad Leonfelden) und Anneliese Bräuer (Oberneukirchen) und der Bezirksjägermeister von Rohrbach, Martin Eisschiel, unterstrichen die Bedeutung dieses gelebten jagdlichen Brauchtums.
Neben heimischen Wildspezialitäten wie feinstem Wildragout und „wilde“ Bratwürstel sowie Käsekrainer und Kistensau gab es erfrischende Getränke und ein Mehlspeisenbuffet. Ein großes Danke für die ausgezeichnete Bewirtung der Festgäste gilt der Jägerschaft Oberneukirchen mit Thomas Hochreiter-Moik und dem Team der Kultur-Werkstatt-Schnopfhagen mit Obmann Herbert Pargfrieder.


TAG DER OFFENEN TÜR IN DER NEUEN JAGDHÜTTE
Meilenstein für Jägerschaft und Gemeinde
Im Rahmen des Rainbacher Kirtags fand am 29. Juni 2025 die feierliche Eröffnung und der Tag der offenen Tür der neuen Jagdhütte mit integriertem Kühlcontainer und modernem Zerlegeraum statt. Mitglieder des Gemeindejagdvorstandes und viele Jägerinnen und Jäger aus den Nachbargemeinden, folgten der Einladung und nutzten die Gelegenheit, sich vor Ort ein Bild von der neuen Einrichtung zu machen.
Die Jagdhütte, zentral im Ort gelegen, stellt eine bedeutende Neuerung für Rainbach dar. Durch die Ausstattung mit professionellen Einrichtungen zur Wildverarbeitung wird nicht nur die Arbeit der Jägerschaft erleichtert – auch die Bevölkerung profitiert direkt. Denn zukünftig wird es möglich sein, frisches, regionales Wildbret direkt im Ortszentrum zu erwerben
– ein wichtiger Schritt in Richtung Regionalität und Nachhaltigkeit. Jagdleiter Alois Wallner bedankte sich beim Gemeinderat und besonders Bürgermeister Gerhard Harant, die durch ihre Bereitschaft das Grundstück zur Verfügung zu stellen, diese Investition in die Zukunft erst möglich machten.
Bürgermeister Harant unterstrich: „Ich freue mich, dass die Jägerschaft nun eine neue Heimat mitten im Ort gefunden hat. Die Jagd ist ein fixer Bestandteil unseres Gemeindelebens, und mit dieser Einrichtung stärken wir die Verbindung zwischen Bevölkerung und Jägern.“

DREI NEUE JAGDSCHUTZORGANE FÜR STEYR
Im Festsaal des Magistrates wurden am 2. Juni 2025 die Jagdschutzorgane Andreas Schützenhofer, Thomas Novak und Markus Nigsch im Beisein
von Bürgermeister Ing. Markus Vogl, der Leiterin der Bezirksverwaltung Mag. Karin Nosko, Fachabteilungsleiter Mag. Alois Scharnreiter, Jagdlei-

ter Thomas Schützenhofer und BJM Rudolf Kern für ihre wichtige Tätigkeit feierlich angelobt.
40 Jahre ist es her, seit das letzte Jagdschutzorgan am Magistrat Steyr für diesen Wirkungsbereich installiert wurde.
Das genossenschaftliche Jagdgebiet von Steyr Stadt, das in vielen Bereichen auch als Naherholungsraum für rund vierzigtausend Bewohner der Stadt dient, bedarf einer Jagdführung und Jagdschutzorganen mit viel Fingerspitzengefühl und Sensibilität. Bemerkenswert ist auch, dass die erlegten mehrjährigen Rehböcke in der JG Steyr-Stadt jährlich (nachhaltig) ein Durchschnittsalter von über 5 Jahren aufweisen.
NEUER OBMANN IM AMT OÖ. BERUFSJÄGER HABEN GEWÄHLT
Die Generalversammlung der Oö. Berufsjäger wurde Anfang Mai in Grünau im Almtal abgehalten. Nach einem Rückblick auf das vergangene Jahr stand die Neuwahl des Vorstands an.
DIE VORSTANDSWAHL BRACHTE FOLGENDES ERGEBNIS
Obmann ist Revieroberjäger Markus Michael Mittermayr, Obmann-Stv. sind Stefan Stoderegger und Thomas Wimmer. Sandra Grafeneder wur-

Als Ehrengäste konnten Landesjägermeister Herbert Sieghartsleitner, der Geschäftsführer des OÖ. Landesjagdverbands Mag. Christopher Böck, LAbg. DI Josef Rathgeb, Bezirksjägermeister Johann Enichlmair und Ehrenmitglied Dr. Wolfgang Ecker sowie von Seiten der OÖ Landarbeiterkammer Präsident Gerhard Leutgeb begrüßt werden.
In den Grußworten wurde die Bedeutung, aber auch die Verantwortung des Berufsstands hervorgehoben. Im Anschluss gaben Obmann WM Helmut Neubacher, Geschäftsführer Dr. Siegfried Glaser und Kassierin Sandra Grafeneder einen Überblick über das vergangene Jahr.
Das bestimmende Thema war vor allem die Berufsjägerausbildung.
de als Kassierin wiedergewählt. Als Rechnungsprüfer stellten sich Wildmeister Andreas Aitzetmüller und DI Klaus Schachenhofer zur Wahl und wurden einstimmig wiedergewählt.
Der neue Obmann Markus Michael Mittermayr freut sich, ein motiviertes Team an seiner Seite zu haben. Der Vorstand möchte sich in den kommenden Jahren auch breiter der Öffentlichkeitsarbeit widmen, um das Berufsjägerwesen positiv nach außen zu präsentieren.
Text und Fotos: OÖ LAK
Herbert Sieghartsleitner und Josef Rathgeb gratulierten dem Obmann und seinen Stellvertretern zur Wahl. V.l.n.r.: Herbert Sieghartsleitner, Thomas Wimmer, Markus Mittermayr, Stefan Stoderegger, Josef Rathgeb.

Im Rahmen der Generalversammlung wurde an Roman Paumann der Berufstitel „Wildmeister“ verliehen. Thomas Lohninger wurde zum Revieroberjäger ernannt. V.l.n.r.: Helmut Neubacher, Thomas Lohninger, Roman Paumann, Herbert Sieghartsleitner, Markus Mittermayr.
VÄTERLICHER FREUND UND WEGBEGLEITER

"Kurt hat als väterlicher Freund, Jagdkamerad und vielgeschätzter Pädagoge wesentlich zu meiner Persönlichkeitsentwicklung als jagdlicher Verantwortungsträger dazu beigetragen, dass ich meine Funktionen so gut wie möglich mache", dankte BJM Rudolf Kern bei seiner Geburtstagsrede für Kurt Ramnek zu dessen 90sten Geburtstag.
Am 06. Juli fanden sich JL Gernot Reisinger, Alt JL Hans Felbauer, Peter
BEZAHLTE ANZEIGE
Sporn, die Ternberger JHB mit BJM Rudolf Kern und viele andere Gratulanten im Garten vom „Direktor“ ein, um ihm herzlich zu gratulieren. Der Jubilar wusste aus über 60 Jahren als aktiver Jäger jede Menge Geschichten von jagdlichen Erlebnissen und Anektoden im In- und Ausland, von Österreich bis Kasachstan zu erzählen.
Tierpräparate Tierpräparate
Wir liefern preiswerte Topqualität!
Trophäenversand: per Post-EMS, tiefgekühlt, in Zeitungspapier eingewickelt.
Prospekt und Preisliste erhalten Sie hier!

IN MEMORIAM HEMMA PFEFFER

Ihr Leben lang – bis zu ihrem letzten Tag – war sie innig und aktiv der heimischen Jagd verbunden. Am 8. April 2025 ist Hemma Pfeffer, geb. Hobetzeder, im 86. Lebensjahr verstorben. Aufgewachsen im damaligen Forsthaus des Stiftes Lambach wurde sie in einem jagd- und forstwirtschaftlichen Alltag von ihrem Großvater Oberförster Georg Krennstetter geprägt. Als Jägerin mit 61 oberösterreichischen Jagdkarten war Hemma Pfeffer zu ihrer Zeit meist Ausnahme und Vorreiterin sowie aktives Mitglied der Jägerschaften Weißkirchen an der Traun und Schleißheim. Das Jägerbegräbnis fand am 30. April 2025 in Schleißheim statt. Weidmannsruh!
A-4694 Ohlsdorf, Ehrenfeld 10 Tel. 07613/3411 · Fax-DW -21 hofinger@praeparator.com www.praeparator.com
Anspruchsvolle Jäger gehen keine Kompromisse ein.
Ausgabe März: 1. Februar
Ausgabe Juni: 1. Mai
Ausgabe Sept.: 1. August
Ausgabe Dez.: 1. November
Jubilar Kurt Ramnek mit Gattin Annemarie und den Gratulanten.
OÖ. JÄGERINNEN: CLUBAUSFLUG 2025 IN DEN WAGRAM
Der traditionelle Ausflug des OÖ. Jägerinnen-Clubs führte im Juli 2025 in das Nachbarbundesland Niederösterreich, in die Region rund um den Wagram. Jagd, Kultur und Tradition kamen dabei nicht zu kurz: die Besichtigung der Amethystwelt Maissau, der Perlmuttmanufaktur in der Nationalparkgemeinde Hardegg, eine Führung durch das Stift Geras und ein Besuch der Kittenberger Erlebnisgärten sowie der kulturelle Abschluss mit einem Konzert im Wolkenturm in Grafenegg.
Höhepunkt des Ausfluges war das Zusammentreffen des kürzlich verabschiedeten Landesjägermeisters von Niederösterreich, Josef Pröll, sowie das Beschießen einer jagdlichen Ehrenscheibe auf seinem elterlichen Weingut in Radlbrunn. Sein Bruder Andreas Pröll mit Gattin Michaela haben das traditionelle Weingut gut aufgestellt an die nächste Generation übergeben. Josef Pröll stand den Jä-

gerinnen für viele Fragen zur Verfügung und hat im Anschluss zu einer Hauerjause eingeladen.
Mit einem herzlichen Weidmannsdank und einem süßen Gruß aus Oberösterreich bedankte sich der OÖ. Jägerinnen-Club für die nachbar-
NEUER WELSER BEZIRKSJÄGERMEISTER LUD JUNGJÄGER ZUR VERLOSUNG

schaftlichen, guten Beziehungen zum Jagdbundesland Niederösterreich und für die bundesweiten Verdienste um die Jagd von Ehrenlandesjägermeister Josef Pröll.
Die Jagden in den Bezirken WelsStadt und Wels-Land dürfen sich wieder über zahlreiche Jungjäger freuen. Pünktlich zum Beginn des neuen Jagdjahres wurden im Bezirk Wels die Jagdprüfungen abgenommen. Bezirksjägermeister Alfred Weinbergmair bat daraufhin die frischgebackenen Jungjägerinnen und Jungjäger aus beiden Welser Jagdkursen ins Gasthaus Zirbenschlössl nach Sipbachzell, wo neben der Verlosung zahlreicher Sachpreise zwei Jungjäger sogar einen Pirschgang auf den Maibock gewinnen konnten.
Die Sipbachzeller Jagdhornbläser umrahmten die Feierlichkeit, die der Bezirksjägermeister nützte, um wesentliche Aspekte der Jagd zu beleuchten und den Jungjägern einige wertvolle Tipps mit auf den Weg zu geben.
Foto:
R. Obermayer
BEACHTLICHE KRÄHENSTRECKE IN BRAUNAU

In der Woche vom 21. - 26.07. fand im Bezirk Braunau eine verstärkte Bejagung der Krähen statt. Bei der Streckenlegung in Auerbach waren 320 Krähen aus 16 Jagden auf der Strecke und 80 leidenschaftliche Krähenjäger berichteten über ihre Erfahrungen, Erfolge aber auch "leere Stunden" am Ansitz. Die Streckenlegung wurde von den Jagdhornbläsern Auerbach würdig umrahmt und die Jägerschaft Auerbach verköstigte die anwesenden Jäger bestens! BJM Hans Priemaier, Roland Pommer
DIE WEIBLICHKEIT IN DER JAGD
Oberösterreich, 8. Mai 1955, Muttertag. Aloisia Auer, Mutter von fünf Kindern, erlegt einen Auerhahn. Zur Feier das Tages wird der Hahn zerwirkt und verkocht. Eine Selbstverständlichkeit.
Im Alltag der Familie Aloisia und Josef Auer war jagen so selbstverständlich wie heute der Einkauf im Supermarkt – geschlechtsneutral.
vom Niederwildausschuss und Landwirtschaftskammerrat und Bezirksbauernkammerobmann Paul Maislinger, selbst praktizierender Jäger, dankten den Krähenjägern für zahlreiche Stunden am Ansitz, würdigten den Nutzen für das Niederwild und eine artenreiche Vielfalt bei Bodenbrütern und Singvögeln und betonten gleichzeitig die Notwendigkeit der zahlreichen Beteiligung aller Jagden für eine nachhaltige Regulierung des derzeit stetig steigenden Krähenbestandes.
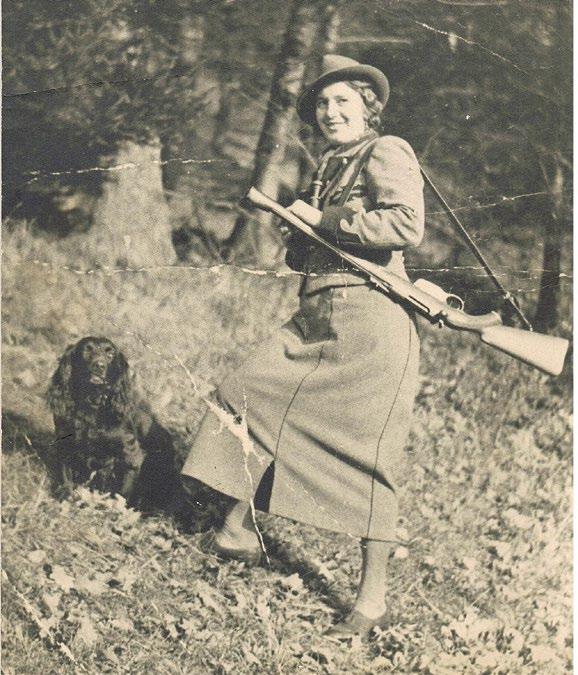
„EINFACH“ 88 …

Lambert Redhammer ist kein Mann des Rampenlichts, hat weder Ämter bekleidet noch die öffentliche Darstellung seiner Person gesucht. In der Jagdgesellschaft Hofkirchen gilt er seit 50 Jahren „einfach“ als verlässlich, rücksichtsvoll, bescheiden und extrem engagiert bei der Wildhege. Seine unermüdliche Motivation und sein Engagement der Jagd gegenüber, üben - eben wegen seines reifen Lebensalters - stets Vorbildwirkung auf die Weidkameraden aus.

Der Jubilar in der Mitte der illustren Runde.
ALUMNI-TREFFEN DER AKADEMISCHEN JAGDWIRTINNEN UND JAGDWIRTE IN OÖ

Ende Juni haben sich die Absolventen der akad. Jagdwirte und Jagdwirtinnen in Hinterstoder getroffen. Vroni Fessl von der FV Dietlgut in Hinterstoder hat diesmal das Treffen organisiert und das Programm zusammengestellt.
Die Mitglieder von Alumni der BOKU-Wien pflegen bei solchen Veranstaltungen, Kontakte der Absolventinnen und Absolventen aus dem In- und Ausland zu schmieden, wodurch Netzwerke entstehen und unterschiedliche Sichtweisen auf die Jagd zu anregenden Diskussionen führen.
Am ersten Tag hat ein Besuch auf Schloss Hohenbrunn stattgefunden, wo offen über die Zukunft der Jagd mit Mag. Christopher Böck, Geschäftsführer des OÖ LJV, diskutiert wurde. Da Jagdwirtinnen und Jagdwirte aus Österreich, Bayern, Nord- und Mitteldeutschland sowie der Schweiz anwesend waren, entfachten sich durch die verschiedenen Perspektiven und Gesetzeslagen interessante Gespräche. Auch das Jagdmuseum wurde besucht und hat großes Interesse geweckt.
Im Anschluss daran wurden im Stift St. Florian die Basilika und Brucknerorgel bestaunt und ein Konzert, u.a.
auch von Anton Bruckner, erlebt. Am späteren Nachmittag fand eine Besichtigung des Forstes der EJ Dietlgut in Hinterstoder statt. Da die Region Pyhrn-Priel-Eisenwurzen Maultrommeln produziert, konnte man beim Abendessen mit dem Ensemble „Maultrommel Schwarz“ den Klang der Maultrommel kennenlernen. Am nächsten Tag wurde der NP Kalkalpen besucht. Mit Dir. DI Sepp Forstinger und Michael Buchebner, von den Bundesforsten, konnten die Teilnehmer einen guten Einblick gewinnen, die Landschaft genießen und anschließend, zurück in Hinterstoder, die FV Württemberg besuchen. FM DI Klaus Schachenhofer gewährte den Teilnehmern Einblicke in die Entwicklung der noch lebenden Hirsche anhand ihrer Abwurfstangen. Zum Abschluss wurde bei strahlendem Sonnenschein in der Dietlkapelle von Landesjägerpfarrer Franz Salcher die Morgenandacht zelebriert, begleitet von den Jagdhornbläsern aus Molln. Agape und Ausklang fanden im Jagdhaus der FV Dietlgut statt, wo die Jagdhornbläser nochmals aufspielten. So endete ein interessantes Wochenende der akad. Jagdwirte in Oberösterreich.
60 JAHRE JÄGER

Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt … Aus gesundheitlichen Gründen konnte Franz Postlbauer aus Dietach beim Bezirksjägertag die Ehrung für 60-jährige Mitgliedschaft zum OÖ Landesjagdverband nicht in Empfang nehmen.
Das wollte der Jubilar nicht auf sich sitzen lassen und veranstaltete ein Fest für Familie, Nachbarn und Jagdkameraden. In diesem festlichen Rahmen erhielt er aus den Händen von BJM Rudolf Kern und Delegierten Walter Winklerebner seine Ehrung.
Die musikalische Umrahmung übernahmen die beim OÖ LJV neu gemeldeten Dietacher Jagdhornbläser.

Landesjägerpfarrer Franz Salcher mit den Jagdhornbläsern aus Molln.
BEEINDRUCKENDE LEISTUNGEN
BEIM BEZIRKSJAGDSCHIESSEN
URFAHR-UMGEBUNG

Bei optimalen Wetterbedingungen fand am 28. Juni das traditionelle Bezirksjagdschießen der Jägerschaft von Urfahr-Umgebung statt.
Bezirksjägermeister Sepp Rathgeb und sein Stellvertreter Norbert Burgstaller als Hauptorganisatoren der Veranstaltung konnten 18 teilneh-
mende Mannschaften mit je 5 Schützen am Wurftaubenstand in Treffling begrüßen. Die Mannschaften beschossen 150 Traptauben und lieferten sich einen fairen Wettkampf.
Bezirkssieger wurde Michael Mittermayr jun. (Mannschaft Engerwitzdorf I) mit 29 Treffern auf 30 Wurftauben vor Bernhard Aichinger (Mannschaft Steyregg I) und Thomas Pichler (Mannschaft Engerwitzdorf I).
Bezirksbeste Mannschaft wurde Engerwitzdorf I mit 126 Treffern vor Steyregg I mit 122 Treffern und Engerwitzdorf II mit 105 Treffern.

HARGELSBERG. Drei Generationen Jäger kamen zusammen, als Johannes Hießmayr Anfang August dieses besondere Weidmannsheil feierte, noch dazu zu seinem 50er. Sein Vater, Johannes, seine Tochter, eine zukünftige Jungjägerin und sein Neffe, ebenfalls passionierter Jäger freuten sich mit dem Schützen. Ein schönes Beispiel gelebter Jagdtradition und den generationsübergreifenden Respekt vor Natur und Wild.

ST. MARIEN. Anfang Juni hatte Thomas Huber in einem großen Waldstück bei St. Marien dieses besondere Weidmannsheil. Der spezielle Bock war weder im Revier vom Schützen, noch in den Nachbarrevieren je zuvor gesehen worden.
BJM-Stv. Norbert Burgstaller, Bezirkssieger Michael Mittermayr, BJM Sepp Rathgeb

PUTZLEINSDORF. Josef Entner, ein Tiroler, der bei einem Kuraufenthalt in OÖ 2002 durch Zufall die Ausschreibung der Jagdleitung in Putzleinsdorf entdeckte und seit damals im besten Einvernehmen mit dem Jagdausschuss und der Jägerschaft die Jagd in Putzleinsdorf führt, hatte ein besonderes Weidmannsheil. Beim Abendansitz konnte er, passender Weise vom sog. „Tirolersitz“, einen außergewöhnlichen Bock erlegen. Das kronenförmig gewachsene Geweih wies 17 Enden auf.

KATSDORF. Benedikt Plöchl gelang während der heurigen Bockjagd ein außergewöhnlicher jagdlicher Erfolg. Innerhalb weniger Ansitzabende konnte er insgesamt fünf Marderhunde – ein Rüde, eine Fähe sowie drei Welpen – sicher mit der Kugel erlegen. In solchen besonderen Momenten zeigt sich eindrucksvoll, wie bedeutend die Ansitzjagd für eine erfolgreiche Prädatorenbejagung sein kann, und wie sehr sie – gemeinsam mit konsequenter Revierpflege –dazu beiträgt, invasive Tierarten einzudämmen und unser Niederwild zu bewahren.


ST. GOTTHARD. In der Nacht zum 3. Juni 2025 ertönte der Alarm der Lebendfangfalle. Bei der anschließenden Kontrolle entdeckte Jagdleiter Andreas Kepplinger einen WaschbärRüden. In St. Gotthard ist es der erste Waschbär, der erlegt wurde. Für Jagdleiter Andreas Kepplinger und der gesamten Jägerschaft St. Gotthard ein besonderes Weidmannsheil.

A B H O L M A R K T: www.gruber-vieh-fleisch.at
Frischfleisch: Hunde-/Katzenfutter: Dienstag und Freitag Freitag 08:00 – 12:00 08:00 – 12:00 14:00 – 17:00 14:00 – 15:30

Telefon: 07247/6747-0 Mail: office@gruber-josef.at
Bezirksgruppe Perg BezirksHubertusmesse

Sonntag, 9. November 2025 um 9 Uhr
Stiftskirche Baumgartenberg

Zelebrant
Landesjägerpfarrer Franz Salcher
Musikalische Umrahmung
Jagdhornbläsergruppe Machland und Jäger 4 Gesang
Im Anschluss Agape
Hier finden Sie eine große Auswahl an Informationsmaterial und Artikeln: ooeljv.at/shop

Jetzt zum Aktionspreis





Sachkundenachweis erforderlich!

WAM® flüssig
• Spritzmittel zum Schutz vor Sommer- und Winterverbiss an Nadel- und Laubgehölzen WAM® extra rosarot

• Streichmittel zum Schutz vor Winterverbiss an Nadel- und Laubgehölzen
• Erhältlich im 1kg, 2,5 kg, und 5 kg Gebinde

Erhältlich bei Grube-Forst!
Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor
PRODUKTE AUF DEM JAGDSEKTOR.

ZERO COMPROMISE OPTIC FEIERT STANDORT–ERWEITERUNG MIT ERFOLGSGESCHICHTE
Am 26. Juni 2025 fand die Veranstaltung von ZCO – Zero Compromise Optic in Österreich/Margarethen am Moos statt. Das Unternehmen, das vor rund sechs Jahren von vier visionären Gründern ins Leben gerufen wurde, kann auf eine beeindruckende Erfolgsgeschichte zurückblicken.

Internationale Partner:innen aus 18 Ländern (4 Kontinenten) sind der Einladung gefolgt. Trotz eines stark umkämpften Marktes und der Tendenz zur Fertigung in Fernost schaffte es ZCO, innerhalb eines Jahres die Qualitätsführerschaft im US-Sportbereich zu erlangen – ausschließlich
durch Kundenfeedback und Social Media. Die Veranstaltung stand ganz im Zeichen dieser Erfolgsgeschichte, die Werte wie Qualität, Verlässlichkeit, Kundennähe und Innovation in den Mittelpunkt stellte. Ein besonderes Highlight war die erstmalige Präsentation der Entwicklung und Fertigung „Made in Austria“. Die internationalen Gäste hatten zudem die Gelegenheit, die Schwesterunternehmen des Konzerns kennenzulernen, die in unterschiedlichen Geschäftsfeldern mit innovativen, weltweit einzigartigen Produkten erfolgreich sind, darunter das Im Rahmen der
Veranstaltung fand eine spannende Podiumsdiskussion mit internationalen Expert:innen statt. Unter den Teilnehmern waren Victor Contreras (Spanien), Mindaugas Kašalynas (Litauen), Diann Pennington (USA), Ken Wheeler (USA) und CEO ZCO Robert Artwohl (Österreich). Sie gaben Einblicke in die technische Entwicklung, die Performance im Einsatz, den USMarkt sowie die Bedeutung von ZCO im Bereich des Sportschießens. “Vision to Reality” Abgerundet wurde der Tag durch Führungen durch die Unternehmen, ein Galadinner mit Live Auftritt der Künstlerin Emely Myles sowie zahlreiche NetworkingMöglichkeiten. „Wir blicken mit großem Optimismus in die Zukunft. Durch unseren Fokus für Qualität, Innovation und Kundenzufriedenheit haben wir viel erreicht, und wir sind fest davon überzeugt, dass wir mit unseren einzigartigen Produkten und unserem starken Team weiterhin neue Maßstäbe setzen werden. Gemeinsam werden wir unsere Position als führender Anbieter in der Optikbranche weiter ausbauen und innovative Lösungen für unsere Kund:innen weltweit entwickeln”, so CEO Robert Artwohl.
www.zcompoptic.com
NEUE. BÜCHER.

www.sternathverlag.at
Michael Sternath
WAIDMANNSHEIL, EUER WOHLGEBOREN!
Die Jagd in alten Postkarten-Ansichten
Seiten: 156 | rund 200 Postkarten
Format: 26 x 32 cm
Preis: € 59,00

Europa steuerte gerade auf den Ersten Weltkrieg zu, da feierte die Ansichtspostkarte ihre Hochblüte. Auch jagdliche Motive wurden gerne versendet. Das häufigste Motiv war der Hirsch. Aber auch Rehe, Sauen, Hasen, Fasanen und Enten fanden den Weg auf die Postkarte, sogar balzende Auerhahnen – und auch balzende Jäger. Der Jäger war überhaupt häufig zu sehen auf Bildpostkarten, die Bevölkerung mochte und achtete ihn damals noch. Der Großteil der Bildpostkarten stammt aus der Zeit zwischen 1895 und 1920. Manche Karte ist um die halbe Welt gereist, manche auch nur innerhalb ein und derselben Stadt.
STOCKER
www.stocker-verlag.com
Eugenie und Gerd H. Meyden
GEMEINSAM
AUF DER PIRSCH
Die Jägerin und der Jäger
Seiten: ca. 160 | Hardcover Format: 13 x 20,5 cm ISBN 978-3-7020-2312-6
Preis: ca. € 22,00

Erstmals veröffentlicht Gerd H. Meyden zusammen mit seiner Frau Eugenie ein Buch: Die gemeinsame Leidenschaft für die Jagd hat dem Ehepaar viele Erlebnisse beschert. Für beide steht nicht das Erlegen der Beute im Vordergrund, sondern das Erleben der Natur und ihrer Geschöpfe sowie das Wahrnehmen der vielfältigen Stimmungen auf dem Ansitz und der Pirsch.
STERNATH
www.sternathverlag.at
DAS GAMSBUCH
Etwas zur Naturgeschichte und zur Jagd vom Gams
Seiten: 240 | Nachdruck (verkürzt)

der 2. Auflage von 1955 | Format: 16,5 x 24 cm
Preis: € 50,00
Das Gamsbuch des Forstmannes und Jägers Hans Fuschlberger, 1939 in erster Auflage erschienen, war lange Jahre das Gebetbuch des Bergjägers. Kein Wunder, erzählt doch der Autor äußerst lebendig und kenntnisreich vom Leben des Gamswildes und – vor allem! – von der Jagd. Hans Fuschlberger war Praktiker durch und durch und kannte den Gams aus ungezählten Reviergängen. Man spürt den Praktiker nicht nur, wenn der Autor das Lebensbild eines Gamsbockes vom Kitz bis zum Tod nachzeichnet, man spürt ihn noch viel mehr, wenn er von der Gamsjagd spricht.
STOCKER
www.stocker-verlag.com
WILD | LIFE | STYLE Jagen in aller Welt
Seiten: 160 | zahlr. Farbabbildungen| Hardcover | Format: 16,5 x 22 cm
ISBN 978-3-7020-2310-2
Preis: ca. € 26,00
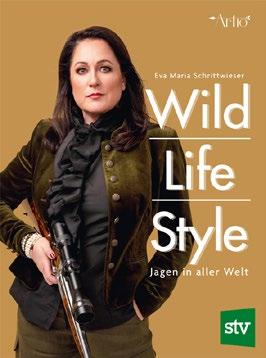
Eine leidenschaftliche Jägerin hat ihr Hobby zum Beruf gemacht: Als Eigentümerin einer Firma, die exklusive Jagdreisen organisiert, begleitet sie ihre Kunden als Jagdleiterin. In ihrem Buch erzählt sie von ihrem Faible für die Jagd von Kindheit an. Sie ist Mitpächterin in ihrem Heimatrevier in Niederösterreich, liebt aber auch die Jagd in den Bergen. Hauptsächlich schildert sie jedoch die Meilensteine ihrer persönlichen jagdlichen Auslandserfahrung, wie eine Steinbockjagd in Kirgisistan, Jagden auf Schwarzbären in Idaho und Montana oder eine spanische „Montería“ und viele weitere beeindruckende Erlebnisse.
Hans Fuschlberger
Eva Maria Schrittwieser
KLEINANZEIGEN
Als aktives Mitglied beim Oö LJV haben Sie die Möglichkeit private Kleinanzeigen auf dieser Seite gratis zu inserieren. Senden Sie einfach den gewünschten Text (am besten als Word-Dokument) mit Angabe Ihrer Kontaktdaten an ooe.jaeger@ooeljv.at und gerne werden wir das Inserat dann kostenlos veröffentlichen. Informationen zu gewerblichen Inseraten bzw. unsere Mediadaten finden Sie auf unserer Website www.ooeljv.at Nehmen Sie diese Serviceleistung in Anspruch. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.
ZU VERKAUFEN
Akazien-Robinien Pfähle zu verkaufen, 1,5, 1,8, 2, 2,5, 3 und 3,5 m Länge, gespitzt und ungespitzt möglich, Durchmesser 6–8, 8–10, 10–12 oder 10–15 cm, Sonderlängen auf Anfrage gerne möglich. Natursalz, Lecksteine im Big Bag oder 25 kg Sack ab € 0,88/kg. Wildzäune in bester Qualität in verschiedenen Ausführungen.
Info: +43/676/84655610 marco@handel-holz.at
Verkaufe Grummet-Kleinballen, Ernte 2025, sehr schönes, junges Futter, ca. 13 kg, noch 350 Stück vorhanden, Preis € 3,-- / Stück, 4575 Roßleithen. Tel: 0664/73443463
Verkaufe Grummet-Rundballen, Ernte 2025, sehr schönes, junges Futter, 125 cm Durchmesser, 30 Stück vorhanden, Preis € 0,19,– / kg, 4575 Roßleithen. Tel: 0664/73443463
Verkaufe ca. 30 Rehbocktrophäen, Schilder und Abwurfstangen u.v.a.m., Besichtigung nach Terminvereinbarung möglich, Tel: 0664/2212845. Preis nach Vereinbarung.
Verkaufe Repetierer Marke Steyr-Mannlicher, Modell M, Kaliber 7x64, 1a Zustand, mit Optik (neuwertig, Neuwert: € 1.500,–) Kahles KXi 3,5 – 10x50 automaticlight, 2 Magazine, inkl. Waffentasche und 50 Stück dazugehörige Patronen um € 2.990,–. Auf Wunsch Bild über WhatsApp oder Besichtigung nach Vereinbarung vor Ort. Tel: 0664/2212845.
Verkaufe Steyr Mannlicher Modell L Kaliber 5,6x57 mit Zielfernrohr Swarovski 6; Sehr guter Zustand, 1A Schussleistung! Preis € 900,–. Tel: 0650/3553654
Verkaufe Steyr Mannlicher-M, Repetierbüchse, 6,5x57, Kahles Zielfernrohr, 6x42; Merkel Bockflinte 200 E, 12/70. Tel: 0650/2603446
Verkaufe Wild für Hundekurse und -prüfungen (Fuchs, Hase, Fasan, Wildenten – auch lebend und Rehschweiß).
Tel: 0676/821256198
Verkaufe Seltene Patronen, RARITÄTEN, 37 Stück Jagdpatronen 8x50 STEYR, Preis: € 15,–pro Stück. Tel: 0699/19217474
Verkaufe aus Alters- und Gesundheitsgründen meine Jagdwaffen wie folgt: 1.) Repetierer 7x64, Achtkantlauf, Gravur, Kahles 6x 42; 2.) NEUEN Repetierer DWM im super Hochwild- und Sauenkaliber 8x64 S, Glas neu Kahles 1,6–8x42 i, neue Schwenkmontage, neuer Schaft, neu brüniert, war noch nie im Revier; 3.) exklusiver HeerenBlockstutzen, Kal. 7 mm RemMag mit Magnaport, Glas Habicht Nova 6x42, Achtkantlauf und sehr schöne Reliefgravur re. Gams, li. Hirsch eingerahmt von Eichenlaub, sehr schönes Schaftholz, Schuppenfischhaut eingerahmt von Eichenlaub; 4.) exklusive Hahnbüchsflinte von Furtschegger/Kufstein, Kal. 6,5x57 R/20/76, Glas Zeiss 6x42 sehr schönes Schaftholz und sehr guter Zustand und Schussleistung. Alle Gewehre eingeschossen und sofort einsatzfähig und bei allen Patronen vorhanden. Bilder gerne per Whatsapp und Preise auf Anfrage. Zwischenverkauf vorbehalten. Tel: 0650/7673346
Verkaufe an Berechtigten HA. Remington 30–06, Model 7400, Glas 1.5–4-5 x 20 um € 1.200,–BBf. Antonio Zoli 7,65-16 Glas 6x42 um € 1.200,– Inkl. Patronen, beide in Topzustand. 300 Stück Sellier u. Bellot 3 mm Schrote 16 mm x 70 mit Papierhülse Pk € 8,–. Besichtigung nach Anfrage möglich, Bez. Linz-Land. Tel: 0650/4620208
Verkaufe: Browning Bockflinte Kal.12/70, Lauflänge 70 cm, Einabzug, mit InvectorChokes 3/4 und 4/4, englisch
geschäftet, wenig gebraucht, gut erhalten. Preis: € 1250,–. Tel: 0650/4191163
HUNDE
Deutsche Jagdterrier vom Fronwald aus jagdlicher Zucht abzugeben. Wurfdatum 13.05.2025 3 Rüden / 1 Hündin; Bei Interesse bitte melden. Franz Scharnböck, Tel: 0664/8915118 und Christoph Raidl, Tel: 0676/4480995
SUCHE
Ankauf: Privatsammler sucht: Jagdtrophäen, Jagdnachlass, Geweihe, Trophäen, Präparate … abischoff57@gmail.com, Tel: 0660/2400031
Suche für 2 tägige Saudrückjagd in Kroatien noch Mitjäger Termin 1: 7.11.–10.11.2025 (3 Plätze); Termin 2: 16.–19.1. 2026 (7 Plätze); Auskunft bei Angabe Tel. und mailadresse unter: gh61@gmx.at
Suche geeigneten Ort für HundeSeminar- und Trainingsstätte Für den Aufbau einer Seminarund Trainingsstätte für Hundeausbildung suche ich ab sofort einen geeigneten Ort im Umkreis von ca. 30 Kilometern rund um Pettenbach (Bezirk Kirchdorf), Vorchdorf, Schlierbach, Wartberg, Inzersdorf, Scharnstein, Kirchdorf, Micheldorf, Grünburg, Steinbach am Ziehberg. Gesucht wird eine Wiese oder ein eingezäunter Platz, idealerweise in Form eines alten Gasthauses, einer Jausenstation, einer leerstehenden Scheune oder eines Bauernhofs. Wichtig ist die Eignung als Trainingsplatz für Hundeseminare und Ausbildung. Optimal wäre eine Lokalität mit sanitären Anlagen und der Möglichkeit zur Verpflegung. Aufgrund der Geräuschentwicklung während des Trainings wird ein abgelegener Standort oder eine Lage mit wenig Nachbarschaft bevorzugt. Ich biete Ihnen: Sorgfältige und respektvolle Nutzung des Geländes, Langfristiges Interesse, Zuverlässigkeit. Ich freue mich über jeden Hinweis, Tipp oder Kontakt! Tel: 0677/61202912
Suche Repetierer, Kal. 8x57 JS ohne Zielfernrohr in gutem Zustand, Kontakt 0664/8941589

IMPRESSUM
Redaktion, Geschäftsführung und Anzeigenverwaltung:
OÖ Landesjagdverband
Schloss Hohenbrunn, Hohenbrunn 1 4490 St. Florian, Telefon: 0 72 24/20 0 83
E-Mail Landesjagdverband: office@ooeljv.at
E-Mail OÖ Jäger: ooe.jaeger@ooeljv.at
Homepage: www.ooeljv.at
Redaktionsausschuss:
Leiter Mag. Christopher Böck, Geschäftsführer und Wildbiologe des Landesjagdverbandes
Mitglieder (in alphabetischer Reihenfolge):
LJM-Stv. Ing. Volkmar Angermeier
Dr. Roman Auer
DI DI Gottfried Diwold
BJM Martin Eisschiel
LJM-Stv. Ing. Andreas Gasselsberger
Johann Hackl
DI Hanspeter Haferlbauer
BJM-Stv. Ing. Elfriede Mayr
Beate Moser
Mag. Benjamin Öllinger
HR DI Josef Rathgeb
GF a. D. Helmut Sieböck
LJM Herbert Sieghartsleitner
Kons. Helmut Waldhäusl
Redaktionschluss:
1. Februar, 1. Mai, 1. August, 1. November Achtung: Kurzfristige Terminänderungen können mitunter nicht berücksichtigt werden.
Herausgeber, Medien-Alleininhaber, Verleger:
OÖ Landesjagdverband, Hohenbrunn 1, 4490 St. Florian
Grafik: 9teufel
Werbung und Kommunikation GmbH
Druck: SKG'Druck, Salzkammergut Media Ges.m.b.H., 4810 Gmunden
Druckauflage: 22.000 Exemplare
Der Oö Jäger dient der Bildung und Information der OÖ Jägerschaft; er erscheint vierteljährlich und gelangt an alle oberösterreichischen Jäger zur Verteilung. Beiträge, welche nicht der offiziellen Meinung des OÖ Landesjagdverbandes entsprechen, sind mit Namen des Autors als solche gekennzeichnet.
Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in der Regel die gewohnte männliche Sprachform bei personenbezogenen Substantiven und Pronomen verwendet. Dies impliziert jedoch keine Benachteiligung des weiblichen Geschlechts, sondern soll im Sinne der sprachlichen Vereinfachung als geschlechtsneutral zu verstehen sein.
SONNE & MOND (Auf- und Untergänge)
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DEZEMBER
S 07:01 16:32 19:45 12:03
D 07:42 16:09 21:26 11:37
M 07:03 16:31 21:06 12:44 10 M 07:43 16:09 22:42 11:56
D 07:04 16:29 22:26 13:13 11 D 07:44 16:09 23:54 12:11 12 M 07:06 16:28 23:43 13:34 12 F 07:45 16:09 - 12:25 13 D 07:08 16:27 - 13:51 13 S 07:46 16:09 01:03 12:38 14 F 07:09 16:26 00:55 14:05 14 S 07:47 16:09 02:11 12:53
15 S 07:11 16:25 02:05 14:18 15 M 07:48 16:09 03:19 13:09
16 S 07:12 16:23 03:13 14:32 16 D 07:48 16:10 04:28 13:28 17 M 07:14 16:22 04:20 14:46 17 M 07:49 16:10 05:38 13:53 18 D 07:15 16:21 05:29 15:03 18 D 07:50 16:10 06:45 14:25 19 M 07:17 16:20 06:38 15:24 19 F 07:50 16:10 07:48 15:08 20 D 07:18 16:19 07:48 15:51 20 S 07:51 16:11 08:41 16:02
21 F 07:20 16:18 08:54 16:25 21 S 07:52 16:11 09:25 17:06 22 S 07:21 16:17 09:54 17:11 22 M 07:52 16:12 09:58 18:16 23 S 07:23 16:17 10:45 18:08 23 D 07:52 16:12 10:24 19:30
M 07:24 16:16 11:25 19:14 24 M 07:53 16:13 10:44 20:44 25 D 07:25 16:15
ACHTUNG! Die Zeitangaben beziehen sich auf den Raum Linz. Bei Leerfeld findet der Mond-Auf-/Untergang bereits am Vor- bzw. Folgetag statt. Quelle: ZAMG
Neumond Halbmond zunehmend Vollmond Halbmond abnehmend

Ein Highlight für Jagdbegeisterte in Österreich!
Gesundes Wild durch die Notzeit – wie füttert man Wild artgerecht
Präsentiert von Fixkraft Spartenleiter Wild, Sebastian Buber auf der Jagatour!

Wir laden zu Vorträgen über Wildfutter & Jagdausrüstung in gemütlicher Atmosphäre mit einem Essen und Getränk ein.
DO, 11.09.25
Gasthaus zum Zirbenschlössl, 4621 Sipbachzell
• Expertenvortrag mit Fixkraft Spartenleiter Wild, Sebastian Buber
• Vortrag „Wärmebildtechnik und Drohnentechnik“ mit Christian Söllinger / Revierkönig
Für mehr Infos und zur Anmeldung QR-Code scannen.
