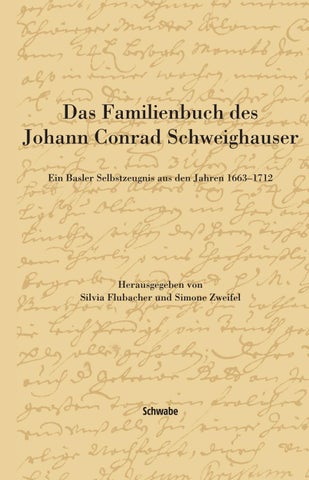8 minute read
Basel zu Zeiten Johann Conrad Schweighausers
16
Wissenschaftlicher Kommentar
Advertisement
Basel zu Zeiten Johann Conrad Schweighausers
von Simone Zweifel
Bevölkerung, Wirtschaft, Politik Im 17. Jahrhundert lebten in Basel, das seit 1501 der Eidgenossenschaft angehörte, ungefähr 10 000 bis 12 000 Menschen. Diese Zahl blieb bis in die Mitte des Jahrhunderts relativ stabil. Danach stieg sie auf über 12 000 Einwohner an, wobei dieser Anstieg vorwiegend auf Geburtenüberschüsse zurückzuführen war. Auch die letzte in Basel wütende Pestepidemie von 1667/68 wirkte sich nur kurzfristig auf die demographische Entwicklung aus – die Verluste dieser Epidemie waren rund zehn Jahre später wieder ausgeglichen. Eine Folge des Bevölkerungswachstums war eine Verschärfung der Einbürgerungspolitik, die in der Abschliessung des Bürgerrechts 1718 ihren Höhepunkt fand.1
Basel war im 17. Jahrhundert von der Zunftverfassung geprägt, welche die meisten Zweige der städtischen Wirtschaft regulierte. Parallel dazu entwickelten sich in einigen Branchen Strategien, die engen Zunftschranken zu unterlaufen. Eine wichtige Stütze der Basler Wirtschaft war der Handel, der von der günstigen Verkehrslage am Rhein und am Schnittpunkt wichtiger Handelswege profitierte. Ebenfalls bedeutsam war die Seidenbandindustrie, die ab Mitte des 16. Jahrhunderts von Refugianten aus Frankreich, Italien und den Niederlanden eingeführt wurde. Gleichzeitig kam
1 Vgl. Burghartz, Susanna. Basel um 1700, in: Heer, Peter W./Kaspar von Greyerz/
Franziska Guyer (Hg.). Vom Weissgerber zum Bundesrat. Basel und die Familie
Brenner, 17.–20. Jahrhundert. Basel 2009, S. 85–101, hier S. 89; Burghartz, Susanna. Das ‹Ancien Régime›, in: Kreis, Georg/Beat von Wartburg. Basel – Geschichte einer städtischen Gesellschaft. Basel 2000, S. 115–147, hier S. 119;
Berner, Hans/Claudius Sieber-Lehmann/Hermann Wichers. Kleine Geschichte der Stadt Basel. Leichenfelden-Echterdingen 2008, S. 79; Maissen, Thomas. Die
Geburt der Republic. Staatsverständnis und Repräsentation in der frühneuzeitlichen Eidgenossenschaft. Göttingen 2008, S. 480; Berner, Hans. «Basel». 3 –
Vom 16. Jahrhundert bis zur Kantonstrennung. 3.1 – Staatsbildung, Regierung und Verwaltung bis zum Ende des Ancien Régime, in: Historisches Lexikon der
Schweiz. Online unter: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D7387-1-8.php [Stand: 17. September 2010].
Basel zu Zeiten Johann Conrad Schweighausers 17
in Basel das Hosenlismerhandwerk auf, so dass – zusammen mit dem Indienne-Gewerbe und der Tuchweberei – in jener Zeit von einer bedeutsamen Textilproduktion gesprochen werden kann. Nach wie vor ein wichtiger Wirtschaftszweig war das Papiergewerbe, auch wenn diesem nicht mehr die gleiche Bedeutung zukam wie noch im 16. Jahrhundert. Im Laufe des 17. Jahrhunderts entbrannte in verschiedenen Gewerbezweigen ein Kampf «zwischen den streng zünftisch geordneten Handwerken und den neuen Produktions- und Wirtschaftsformen», zu denen beispielsweise Verlagssystem und Manufaktur zu zählen sind. Aus diesen Auseinandersetzungen gingen die Vertreter des Handels und der Protoindustrie meist als Sieger hervor, so dass der Einfluss der Handwerker geschwächt wurde.2
Das politische System Basels im Ancien Régime basierte auf 15 Zünften. Diese Form hatte sich beinahe gleichzeitig mit der Reformation von 1529, zwischen 1521 und 1529, durchgesetzt. In den Zünften versammelten sich Bürger gleicher oder ähnlicher Berufsgruppen, wobei es für jeden Bürger Pflicht war, einer Zunft anzugehören, wenn er im Gewerbe oder im Handel tä-
2 Vgl. Burghartz, Basel um 1700, S. 90; Burghartz, Das ‹Ancien Régime›, S. 121f., 124; Fink, Paul. Vom Passementerhandwerk zur Bandindustrie. Ein Beitrag zur
Geschichte des alten Basel (=Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige). Basel 1979, S. 17; Guyer, Franziska. Ein Hosenlismer zwischen Zunft und Verlag –
Johannes Brenner-Euler (1639–1700), in: Heer, Peter W./Kaspar von Greyerz/
Franziska Guyer (Hg.). Vom Weissgerber zum Bundesrat. Basel und die Familie
Brenner, 17.–20. Jahrhundert. Basel 2009, S. 43–83, hier S. 47; Röthlin, Niklaus. Die Basler Handelspolitik und deren Träger in der zweiten Hälfte des 17. und im 18. Jahrhundert. Dissertation (=Basler Beiträge zur Geschichtswissenschaft 152). Basel/Frankfurt am Main 1986, S. 17, 23, 35f.; Berner/Sieber-Lehmann/Wichers, Kleine Geschichte, S. 132; Berner, Hans/Niklaus Röthlin. «Basel». 4 – Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur von der Reformation bis zur
Kantonstrennung. 4.2 – Wirtschaft, in: Historisches Lexikon der Schweiz. Online unter: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D7478-1-15.php [Stand: 17. September 2010]; Christ, Bernhard. Die Basler Stadtgerichtsordnung von 1719. Als Abschluss der Rezeption in Basel (=Basler Studien zur Rechtswissenschaft 87). Basel/Stuttgart 1969, S. 111f.; Senn, Philipp. «Ein jeder schmachtet unter gleichem druk». Die Welt des Klein- und Grossbasler Gewerbes 1770–1830. Unveröffentlichte Lizentiatsarbeit an der Universität Basel. Basel 2009, S. 76f., 79–81. Zitat:
Röthlin, Basler Handelspolitik, S. 17.
18
Wissenschaftlicher Kommentar
tig sein wollte. Neben ihrer wirtschaftlichen Funktion waren die Zünfte auch Wahlkörper des Grossen und des Kleinen Rates. Die Mitgliedschaft in einer Zunft bedeutete jedoch nicht automatisch die aktive Wahlberechtigung: Diese stand nur den Zunftvorständen zu. Da die Ämter der Zunftvorstände nur bescheiden oder gar nicht besoldet, dabei aber mit Auslagen, beispielsweise für Geschenke an die Zunftbrüder, verbunden waren, war es für einfache Bürger schwierig, diese zu besetzen. Wohl auch deshalb wurde die 1552 in Zünften mit Bezug zu Handel und Export eingeführte Mehrzünftigkeit akzeptiert, welche die Chance der mehrzünftigen Handelsleute, Offiziere und Beamten auf einen Ratssitz erhöhte. Dadurch wuchs deren Anteil in den Zunftvorständen zu Lasten der Handwerker, so dass diese nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch an Bedeutung verloren.3
Das mächtigste politische Gremium Basels im 17. Jahrhundert war der Dreizehnerrat, der auch Geheimer Rat genannt wurde. Die-
3 Siehe Berner, Hans/Niklaus Röthlin. «Basel». 4 – Gesellschaft, Wirtschaft und
Kultur von der Reformation bis zur Kantonstrennung. 4.3 – Gesellschaft, in: Historisches Lexikon der Schweiz. Online unter: /http://www.hls-dhs-dss.ch/ textes/d/D7478-1-16.php [Stand: 17. September 2010]; Im Hof, Ulrich. Vom politischen Leben im Basel des 18. Jahrhunderts, in: Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 48 (1949), S. 141–166, hier S. 143–146; Röthlin,
Basler Handelspolitik, S. 16–19; Fink, Paul. Geschichte der Basler Bandindustrie. 1550–1800 (=Basler Beiträge zur Geschichtswissenschaft 147). Basel 1983,
S. 10f.; Müller, Alfred. Die Ratsverfassung der Stadt Basel von 1521 bis 1798, in: Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 53 (1954), S. 5–98, hier S. 8–11; Stolz, Peter. Wirtschaftspolitik und Gruppeninteressen im alten Basel (1670–1798), in: Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik 110 (1974), S. 551–579, hier S. 558; Schüpbach-Guggenbühl, Samuel. Schlüssel zur Macht. Verflechtungen und informelles Verhalten im Kleinen Rat zu Basel, 1570–1600, Bd. 1. Dissertation (=Basler Beiträge zur Geschichtswissenschaft 173). Basel 2002, S. 62f.; Stolz, Wirtschaftspolitik und Gruppeninteressen,
S. 558; Stolz, Peter. Basler Wirtschaft in vor- und frühindustrieller Zeit. Ökonomische Theorie und Wirtschaftsgeschichte im Dialog. Zürich 1977, S. 138; Felder, Pierre. Ansätze zu einer Typologie der politischen Unruhen im Schweizerischen Ancien Régime, 1712–1789, in: Schweizerische Zeitschrift für Geschichte 26 (1976), S. 324–389, hier S. 349. Den Zunftvorständen gehörten Zunftmeister,
Zunftratsherren sowie Sechser an. Vgl. Müller, Ratsverfassung der Stadt Basel,
S. 11f.
Basel zu Zeiten Johann Conrad Schweighausers 19
ser war in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts als Kriegsrat gebildet worden und hatte mit der Zeit immer mehr Machtbereiche vom Kleinen Rat übernommen. Ähnlich einer heutigen Regierung kümmerte sich der Geheime Rat unter anderem um die Ausführung von Ratsbeschlüssen, kontrollierte die Beamten, war für das städtische Finanzwesen verantwortlich und führte weitgehend die Korrespondenz nach aussen. Im 17. Jahrhundert wurden die Mitglieder des Dreizehnerrates, der aus den vier Häuptern des Kleinen Rates – also den Bürgermeistern und Oberstzunftmeistern – sowie neun Kleinräten bestand, nicht mehr wie früher vom Kleinen Rat gewählt, sondern durch Kooptation, d.h., sie ergänzten sich selbst.4
Für die Gesetze und Verordnungen der Stadt sowie die Exekutive war vor 1691 allein der Kleine Rat zuständig, der zweimal wöchentlich tagte. Diesem gehörten Ratsherren und Zunftmeister an, wobei die Zunftmeister vom Zunftvorstand ernannt wurden, während sich die übrigen Kleinräte wie die Geheimen Räte selbst ergänzten. Zudem war der Kleine Rat jenes Gremium, auf welches der Jahreseid abgelegt wurde.5
4 Röthlin, Basler Handelspolitik, S. 54f.; Vettori, Arthur. Finanzhaushalt und Wirtschaftsverwaltung Basels (1689–1798). Wirtschafts- und Lebensverhältnisse einer Gesellschaft zwischen Tradition und Umbruch. Dissertation (=Basler Beiträge zur Geschichtswissenschaft 149). Basel 1984, S. 96; Alioth, Martin/Ulrich
Barth/Dorothee Huber. Basler Stadtgeschichte 2: vom Brückenschlag 1225 bis zur Gegenwart. Basel 1981, S. 71; Im Hof, Vom politischen Leben, S. 145;
Schüpbach-Guggenbühl, Schlüssel zur Macht, S. 66–68, 78f.; Müller, Ratsverfassung der Stadt Basel, S. 41; Burghartz, Basel um 1700, S. 94; Grollimund,
Timo. «O Basel du ganz verrufte Statt». Die Basler Staatskrise von 1691 im Kontext der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts unter besonderer Berücksichtigung der politischen Rahmenbedingungen. Unveröffentlichte Lizentiatsarbeit am Historischen Seminar der Universität Basel. Basel 2004, S. 21; Stähelin, Andreas.
«Zum 1691er Wesen». Unveröffentlichte Notizen am Historischen Seminar der
Universität Basel. Basel 1976/1977, o.S, in: StABS, Privatarchiv 904,2 (1). Zum
Begriff der Kooptation siehe Steiner, Peter. «Kooptation», in: Historisches Lexikon der Schweiz. Online unter: http://hls-dhs-dss.ch/index.php [Stand: 17. September 2010]. 5 Zum letzten Abschnitt siehe Müller, Ratsverfassung der Stadt Basel, S. 1, 59–61;
Müller, Alfred. Die Ratsverfassung der Stadt und Republik Basel von der Reformation bis zur Helvetik (1529–1798). Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde einer hohen Juristischen Fakultät der Universität Basel. Basel 1945,
20
Wissenschaftlicher Kommentar
Der Grosse Rat repräsentierte die Gemeinde oder des Mehrern Gewalts. Dieser setzte sich seit 1373 aus den Sechsern, den 36 Vorständen der Kleinbasler Ehrengesellschaften sowie den Mitgliedern des Kleinen Rates zusammen und durfte sich bis 1691 nur auf Ankündigung des Kleinen Rates versammeln. Im 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts wurde der Grosse Rat bei sämtlichen wichtigen Fragen des Kleinen Rates beigezogen. Bis 1691 nahm die Zahl der Einberufungen des Grossen Rates stetig ab, wodurch dessen Bedeutung allmählich kleiner wurde.6
Die Unruhen von 1691 Die schwindende Bedeutung des Grossen Rates war vermutlich eine der Ursachen, die zu den Unruhen von 1691 führten.7 Ein weiterer Grund dafür könnte die schlechte Verwaltung «der Gemeinen insonderheit aber der Geistlichen güeteren» gewesen
S. 28; Stolz, Basler Wirtschaft, S. 137; Burghartz, ‹Ancien Régime›, S. 129; Grollimund, «O Basel du ganz verrufte Statt», S. 21; Schüpbach-Guggenbühl,
Schlüssel zur Macht, S. 61. 6 Vgl. Müller, Ratsverfassung der Stadt Basel, S. 13, 35–37; Kutter, Markus. 1691:
Ergebnislos, aber folgenschwer, in: Basler Stadtbuch 112 (1991), S. 45–48, hier
S. 46; Im Hof, Vom politischen Leben, S. 145; Burghartz, ‹Ancien Régime›,
S. 129; Würgler, Unruhen und Öffentlichkeit. Städtische und ländliche Protestbewegungen im 18. Jahrhundert. Tübingen 1995, S. 35–37, 46; Stähelin, «Zum 1691er Wesen», o.S.; Grollimund, «O Basel du ganz verrufte Statt», S. 23; Oeri,
Albert. Aus einer bösen Zeit, in: Sonntagsblatt der Basler Nachrichten 31 (2. August 1925), S. 129–146, hier S. 130; Vettori, Finanzhaushalt, S. 91; Würgler, Unruhen und Öffentlichkeit, S. 50; Röthlin, Basler Handelspolitik, S. 124; Maissen,
Thomas. Zum politischen Selbstverständnis der Basler Eliten, 1501–1798, in:
Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 100 (2000), S. 19–40, hier
S. 33; Christ, Basler Stadtgerichtsordnung, S. 5. 7 In Bezug auf diesen innerstädtischen Konflikt in Basel wird in der Forschung vor allem von den «Einundneunziger Wirren», vom 1691er-Wesen und von Bürgerprotesten oder Unruhen gesprochen. Vgl. Grollimund, «O Basel du ganz verrufte
Statt», S. 9; Im Hof, Vom politischen Leben, S. 146; Alioth/Barth/Huber, Basler
Stadtgeschichte 2, S. 68; Stähelin, «Zum 1691er Wesen», o.S.; Würgler, Unruhen und Öffentlichkeit, S. 46. Obwohl der Begriff der Unruhe laut Würgler, Unruhen und Öffentlichkeit, S. 29, eine «obrigkeitliche Optik wiedergibt», scheint er mir, nach folgender Begriffsdefinition Blickles dennoch am besten zu passen:
«Unruhen sind […] Protesthandlungen von (mehrheitlich) allen Untertanen einer