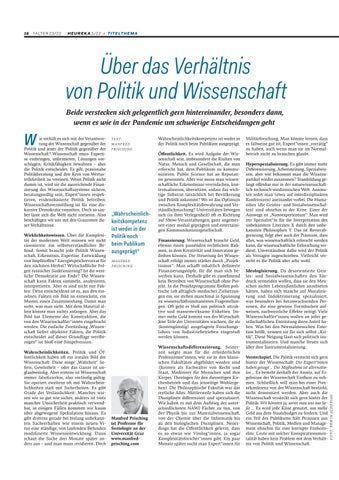16
FALTER 23/22
HEUR EKA 3/22 : T I T ELT HE MA
Über das Verhältnis von Politik und Wissenschaft Beide verstecken sich gelegentlich gern hintereinander, besonders dann, wenn es wie in der Pandemie um schwierige Entscheidungen geht ie verhält es sich mit der Verantwortung der Wissenschaft gegenüber der Politik und jener der Politik gegenüber der Wissenschaft? Wissenschaft muss Expertise einbringen, informieren, Lösungen vorschlagen, Kritikfähigkeit bewahren – aber die Politik entscheidet. Es gilt, praxisnahe Politikberatung und den Kern von Werturteilsfreiheit zu vereinen. Wenn Politik nicht dumm ist, wird sie die ausreichende Finanzierung des Wissenschaftssystems sichern, beratungswillig sein, Expert*innen respektieren, evidenzbasierte Politik betreiben. Wissenschaftsvermittlung ist für eine diskursive Demokratie vonnöten. Doch so sauber lässt sich die Welt nicht sortieren. Also beschäftigen wir uns mit den Grauzonen dieser Verhältnisse. Wirklichkeitswissen. Über die Komplexität der modernen Welt müssen wir nicht räsonieren: ein selbstverständlicher Befund. Somit braucht jede Politik Wissenschaft, Erkenntnis, Expertise. Entwicklung von Impfstoffen? Energiespeichervorrat für den nächsten Herbst? Wirtschaftliche Folgen russischer Sanktionierung? Ist die westliche Demokratie am Ende? Die Wissenschaft kann Fakten sammeln, analysieren, interpretieren. Aber es sind nicht nur Fakten: Denn entscheidend ist es, aus den einzelnen Fakten ein Bild zu entwickeln, ein Muster, einen Zusammenhang. Damit man sieht, was man sieht. Mit dem Material allein könnte man nichts anfangen. Aber das Bild hat Elemente der Konstruktion, die von den Wissenschaftler*innen eingebracht werden. Die einfache Zweiteilung „Wissenschaft liefert objektive Fakten, die Politik entscheidet auf dieser Grundlage wertbezogen“ ist bloß eine Simpelversion. Wahrscheinlichkeiten. Politik und Öffentlichkeit haben oft ein irreales Bild der Wissenschaft: Diese möge „Wahrheit“ liefern, Gewissheit – oder das Ganze ist unglaubwürdig. Aber erstens ist Wissenschaft immer falsifizierbar, also vorläufig gültig. Sie operiert zweitens oft mit Wahrscheinlichkeiten statt mit Sicherheiten. Es gibt Grade der Verlässlichkeit: Manches wissen wir so gut wie sicher, anderes ist trotz mancher Unsicherheit praktisch verwendbar, in einigen Fällen kommen wir kaum über abgewogene Spekulation hinaus. Es gibt drittens gerade bei bislang unbekannten Sachverhalten wie einem neuen Virus eine ständige, von laufenden Befunden modifizierte Wissensentwicklung. Dann schaut die Sache drei Monate später anders aus – und man muss revidieren. Doch
TEXT: MANFRED PRISCHING
„Wahrscheinlichkeitskompetenz ist weder in der Politik noch beim Publikum ausgeprägt“ MANFRED PRISCHING
Manfred Prisching ist Professor für Soziologie an der Universität Graz www.manfredprisching.com
Wahrscheinlichkeitskompetenz ist weder in der Politik noch beim Publikum ausgeprägt. Öffentlichkeit. Es wird Aufgabe der Wissenschaft sein, insbesondere die Risiken von Natur, Mensch und Gesellschaft, die man erforscht hat, dem Publikum zu kommunizieren. Public Science hat an Reputation gewonnen. Aber wie muss man wissenschaftliche Erkenntnisse vereinfachen, kontextualisieren, übersetzen, sodass das wichtige Substrat tatsächlich bei Bevölkerung und Politik ankommt? Wo ist das Optimum zwischen Komplexitätsbewahrung und Verständlichmachung? Universitäten bewegen sich (in ihrer Verlegenheit) oft in Richtung auf Show-Veranstaltungen, ganz angemessen einer medial geprägten und entertainigen Kommunikationsgesellschaft. Finanzierung. Wissenschaft braucht Geld, ebenso einen passenden rechtlichen Rahmen, in dem Kreativität und Innovation gedeihen können. Die Steuerung der Wissenschaft erfolgt immer stärker durch „Projektismus“: Man schafft inhaltlich definierte Finanzierungstöpfe, für die man sich bewerben kann. Deshalb gibt es zunehmend kein Betreiben von Wissenschaft ohne Projekt. In die Projektprogramme fließen politische (oft alltäglich-modische) Zielsetzungen ein, sie stehen manchmal in Spannung zu wissenschaftsimmanenten Fragestellungen. Oft geht es bloß um politisch attraktive und massenwirksame Etiketten. Immer mehr Geld kommt von der Wirtschaft: Jene Teile der Universitäten wachsen, die als (kostengünstig) ausgelagerte Forschungslabors von Industriebetrieben eingestuft werden können. Wissenschaftsdifferenzierung. Seinerzeit sorgte man für die erforderlichen Professionist*innen, wie sie in den klassischen Fakultäten abgebildet worden sind (Juristen als Sachwalter von Recht und Staat, Mediziner für Menschen und ihre Körper, Theologen für den diesseitigen Kirchenbetrieb und das jenseitige Wohlergehen). Die Philosophische Fakultät war das restliche Alles. Mittlerweile haben sich die Disziplinen differenziert und spezialisiert. Wir haben es mit dem Aufstieg der unterschiedlichsten NAWI-Fächer zu tun, von der Physik bis zur Materialwissenschaft, von der Chemie über die Informatik bis zu den biologischen Disziplinen. Neuerdings hat die Öffentlichkeit gelernt, dass es so etwas wie Virolog*innen, ja sogar Komplexitätsforscher*innen gibt. Ein paar Monate später sucht man Expert*innen für
Militärforschung. Man könnte lernen, dass es fallweise gut ist, Expert*innen „vorrätig“ zu haben, auch wenn man sie im Normalbetrieb nicht zu brauchen glaubt. Hyperspezialisierung. Es gibt immer mehr Differenzierung, Arbeitsteilung, Spezialwissen; aber wie bekommt man die Wissenspartikel wieder zusammen? Teambildung gelingt offenbar nur in der naturwissenschaftlich-technisch-medizinischen Welt. Ansonsten redet man (etwa auf interdisziplinären Konferenzen) aneinander vorbei. Die Humanities (die Geistes- und Sozialwissenschaften) sind ohnehin in der Krise. Einer der Auswege ist „Nanoexpertentum“: Man wird zur Spezialist*in für die Interpretation des unbekannten Literaten X durch den unbekannten Philosophen Y. Das ist Revierabgrenzung, folgt aber auch der Prämisse, dass alles, was wissenschaftlich erforscht werden kann, die wissenschaftliche Erforschung verdient. Unverständnis dafür wird der Politik als Versagen zugeschrieben. Vielleicht versteht es die Politik aber sehr wohl. Ideologisierung. Da desorientierte Geistes- und Sozialwissenschaften den Eindruck vermeiden wollen, dass sie den Menschen nichts Lebensdienliches anzubieten hätten, haben sich manche auf Moralisierung und Indoktrinierung spezialisiert, was besonders bei heranwachsenden Personen, die eine gewisse Formbarkeit aufweisen, nachweisliche Effekte zeitigt. Viele Wissenschaftler*innen wollen an jeder gesellschaftlichen Entrüstung ihren Anteil haben. Was bei den Normalmenschen Emotion heißt, nennen sie für sich selbst „Kritik“. Diese Neigung lässt sich politisch instrumentalisieren. Und manche freuen sich über ihre Instrumentalisierung. Versteckspiel. Die Politik versteckt sich gern hinter der Wissenschaft: Die Expert*innen haben gesagt … Die Maßnahme ist alternativlos … Es besteht deshalb der Anreiz, auf Ergebnisse der Wissenschaft Einfluss zu nehmen. Schließlich will man bei einer Pressekonferenz von der Wissenschaft bestärkt, nicht demontiert werden. Aber auch die Wissenschaft versteckt sich gern hinter der Politik: Wir könnten ja, wenn man uns nur ließe ... Es wird jede Krise genutzt, um mehr Geld aus dem Staatsbudget zu fordern. Und ein Teil des Publikums hält Personen aus Wissenschaft, Politik, Medien und Management ohnehin für eine korrupte Einheitselite. Leute mit solcher Konspirationsmentalität haben kein Problem mit dem Verhältnis von Politik und Wissenschaft.
FOTO: ERWIN SCHERIAU
W